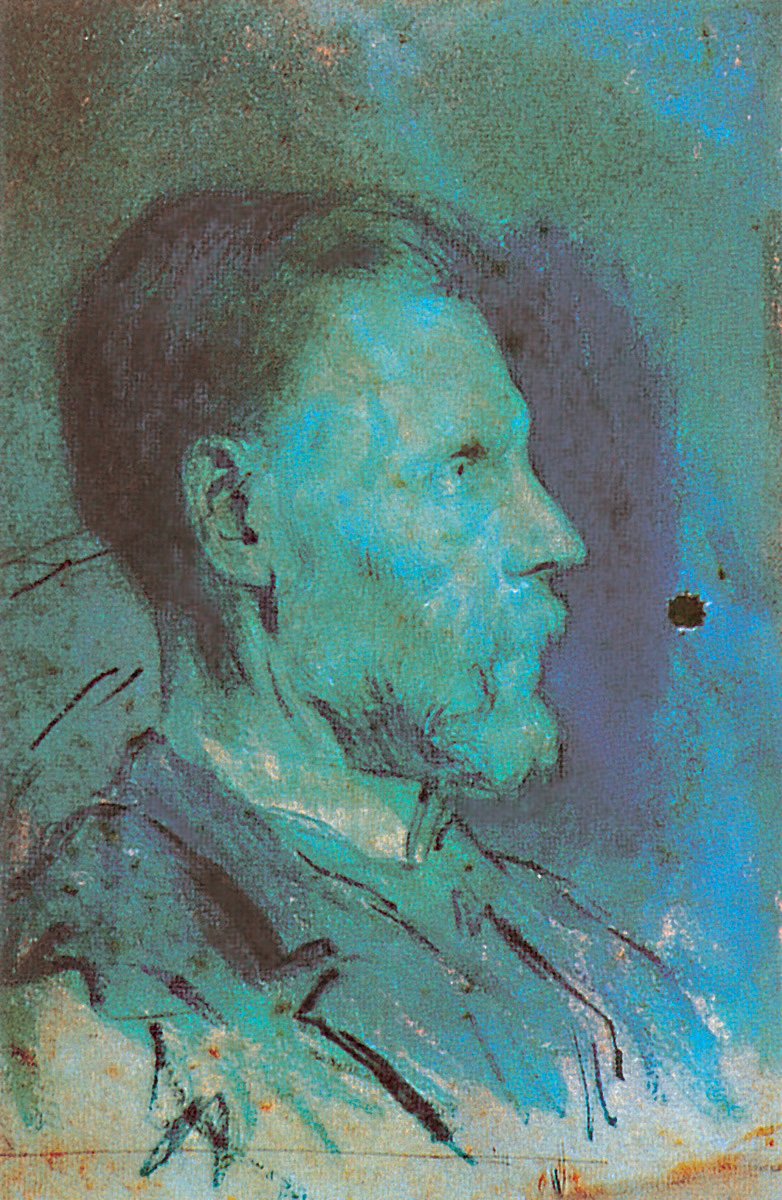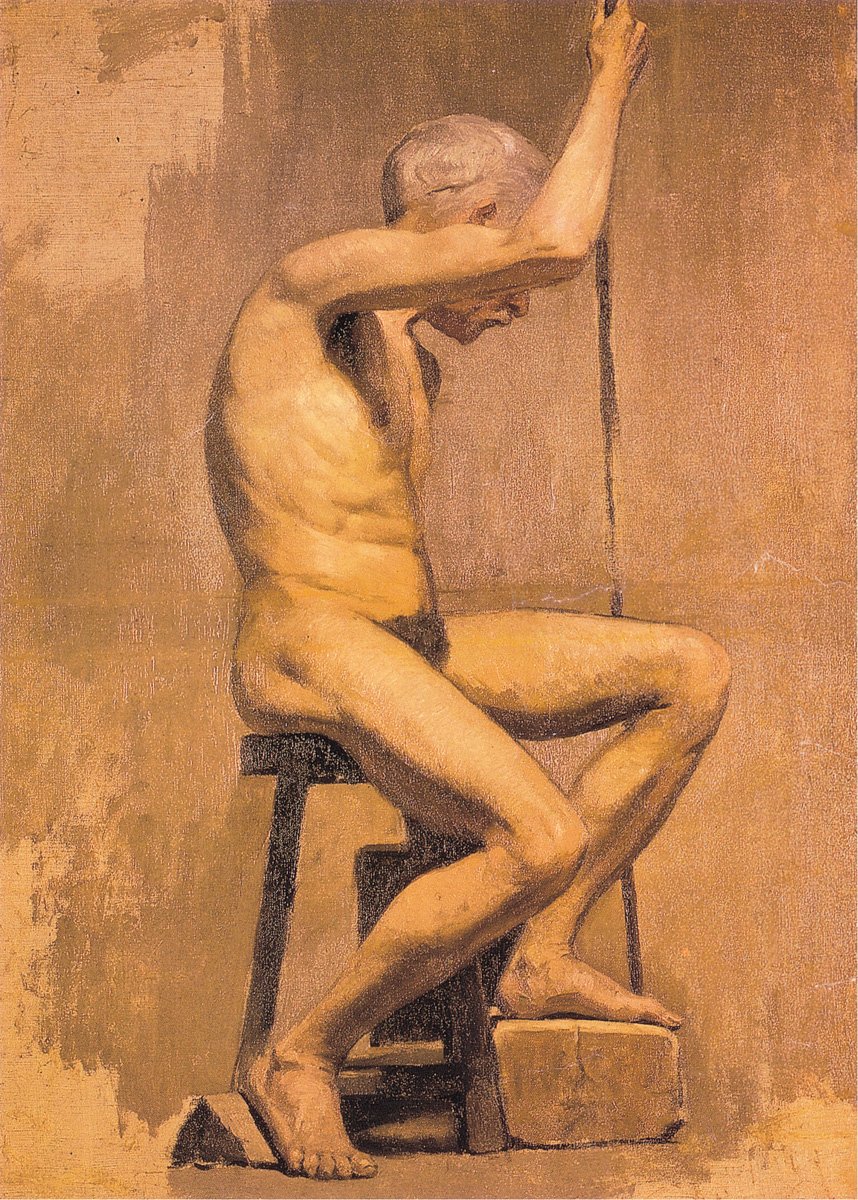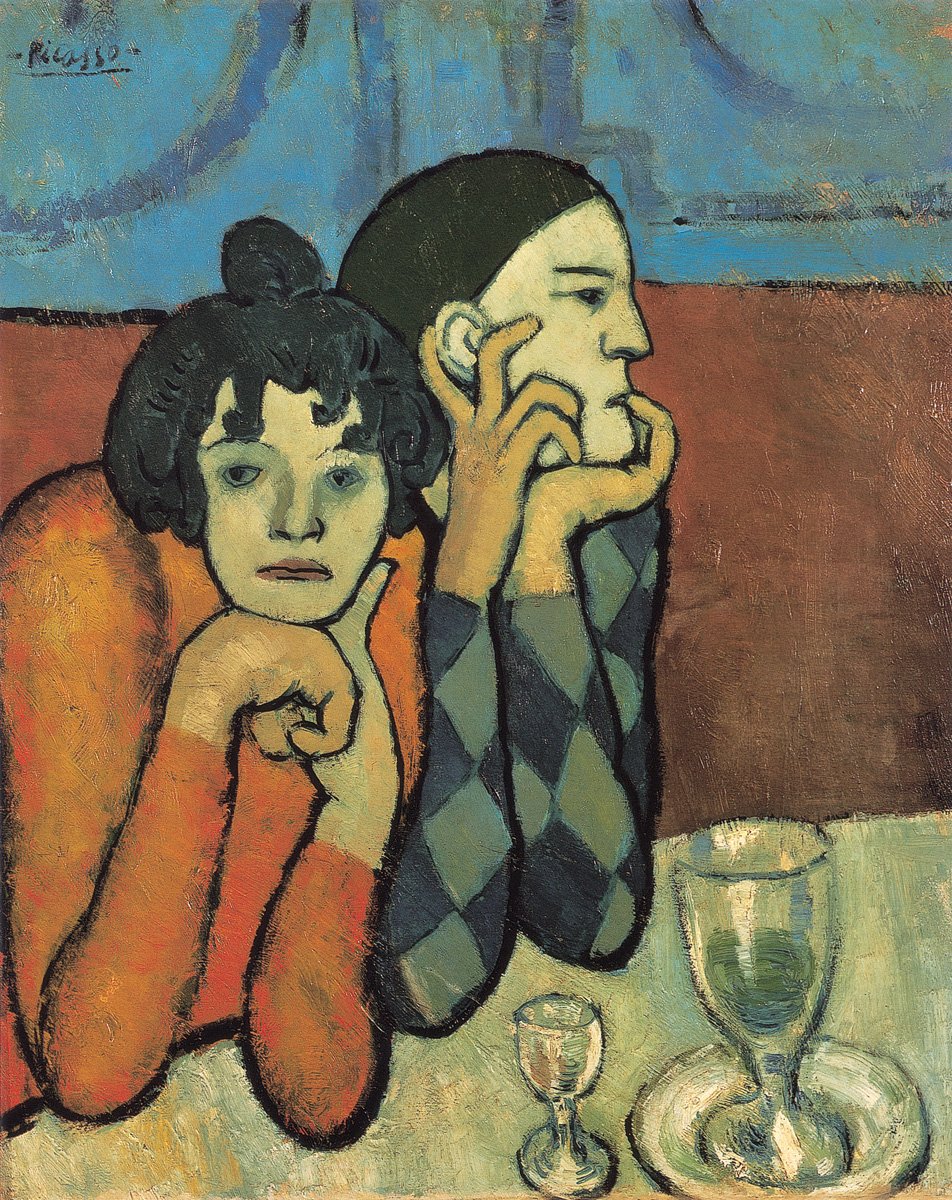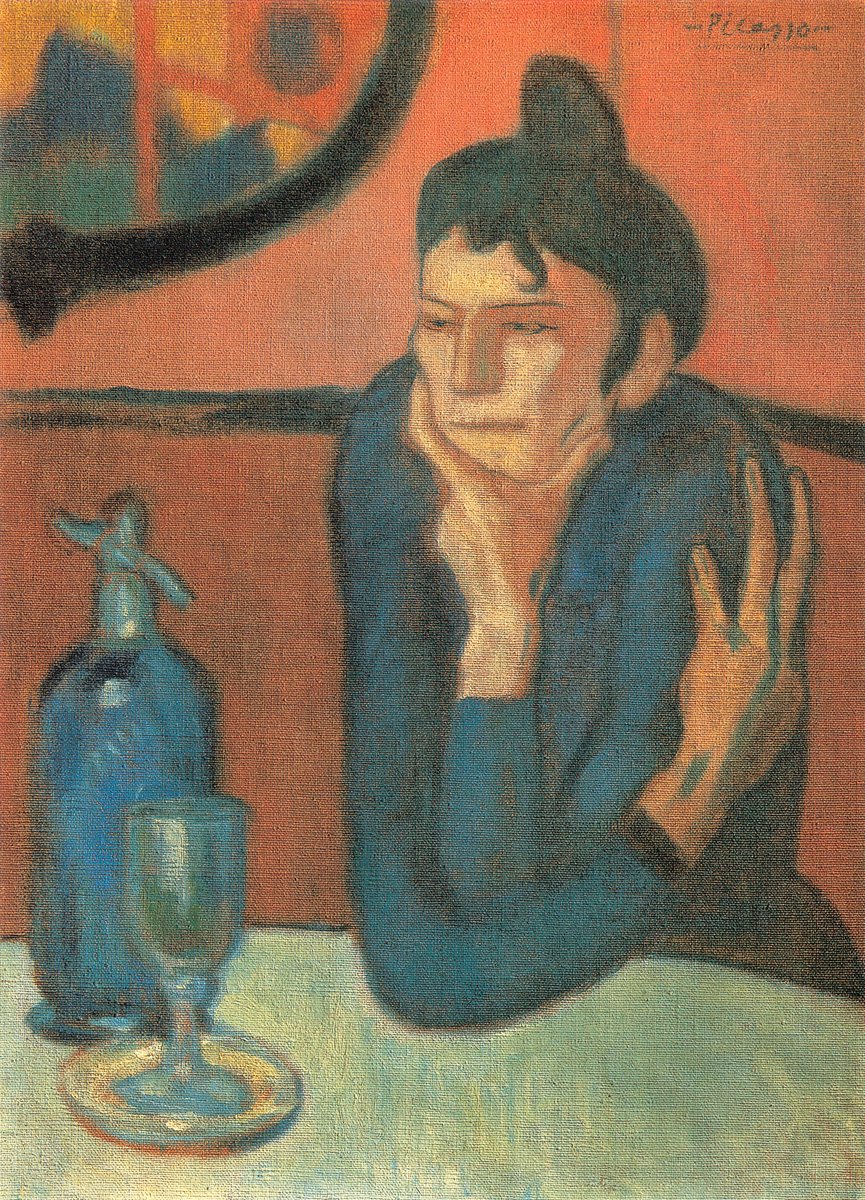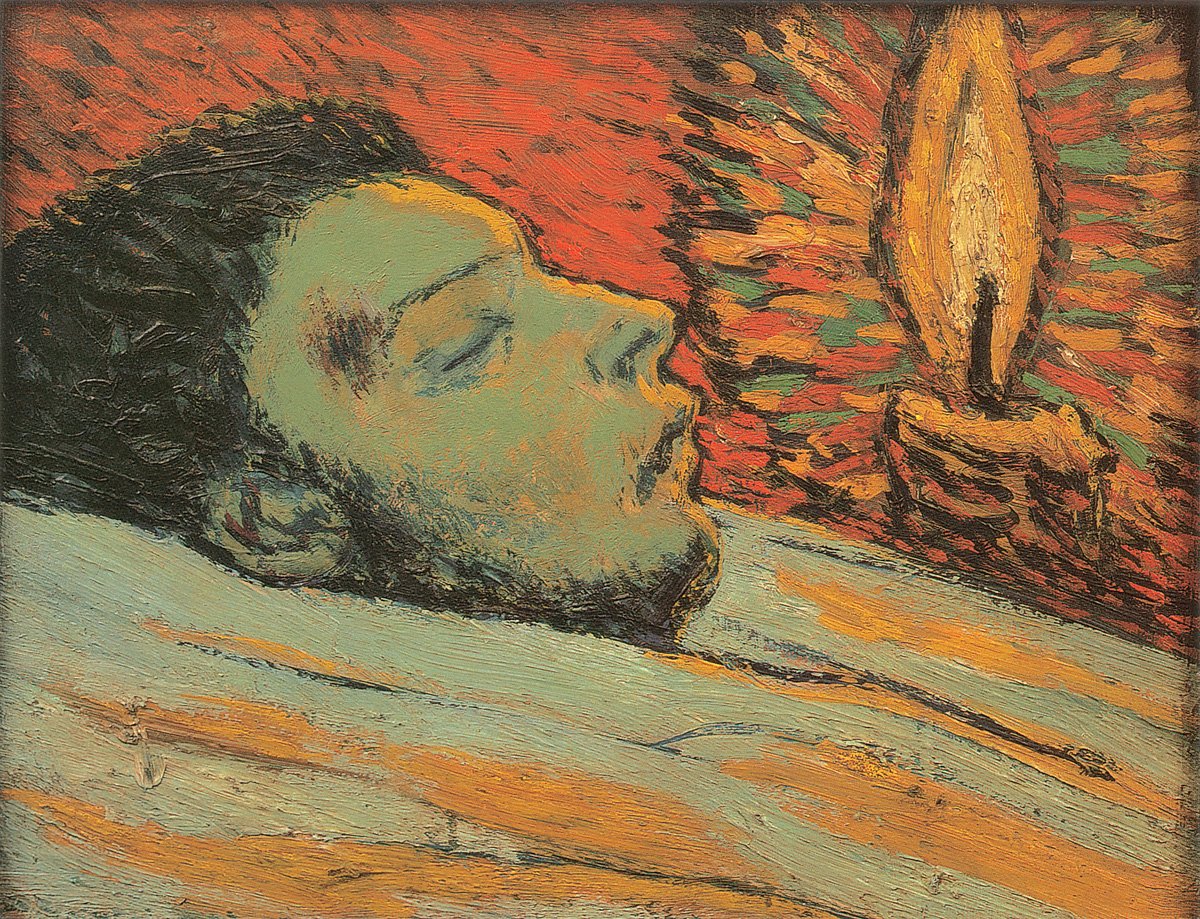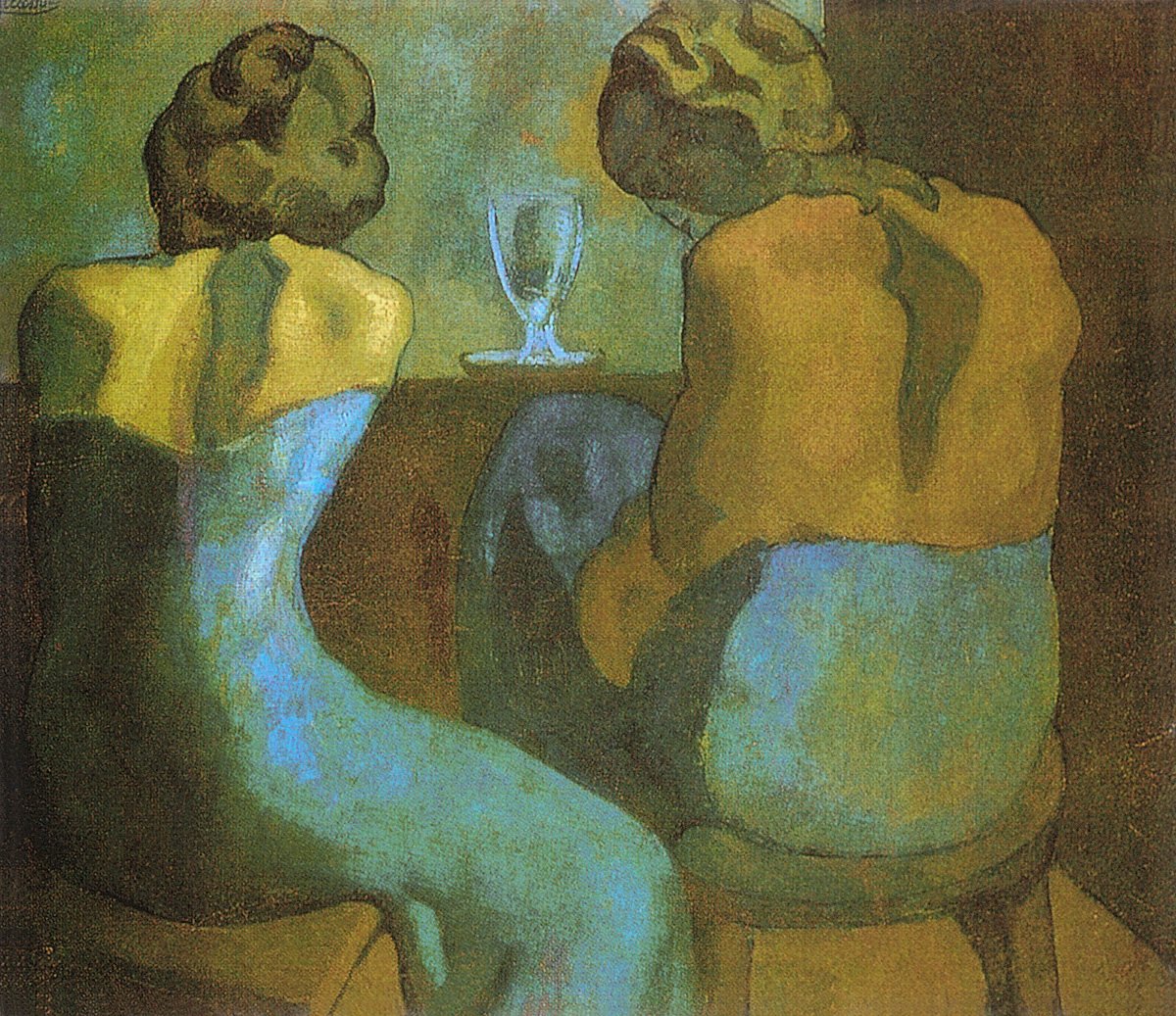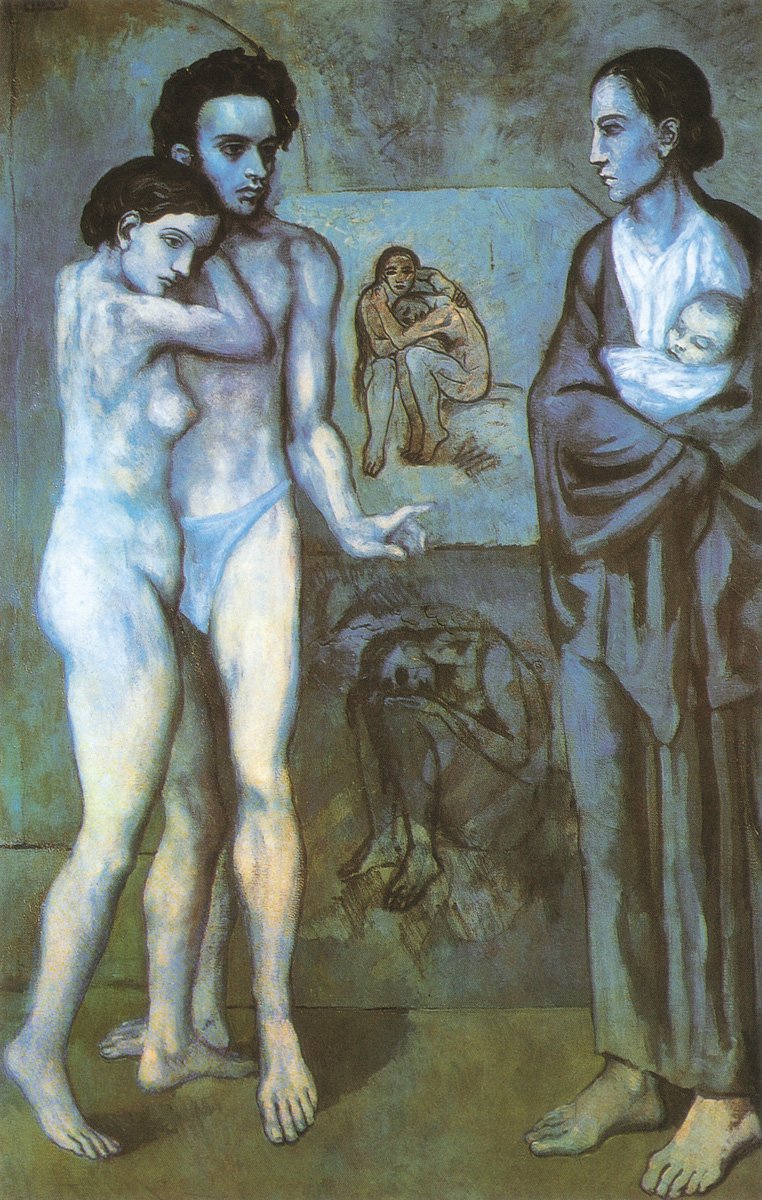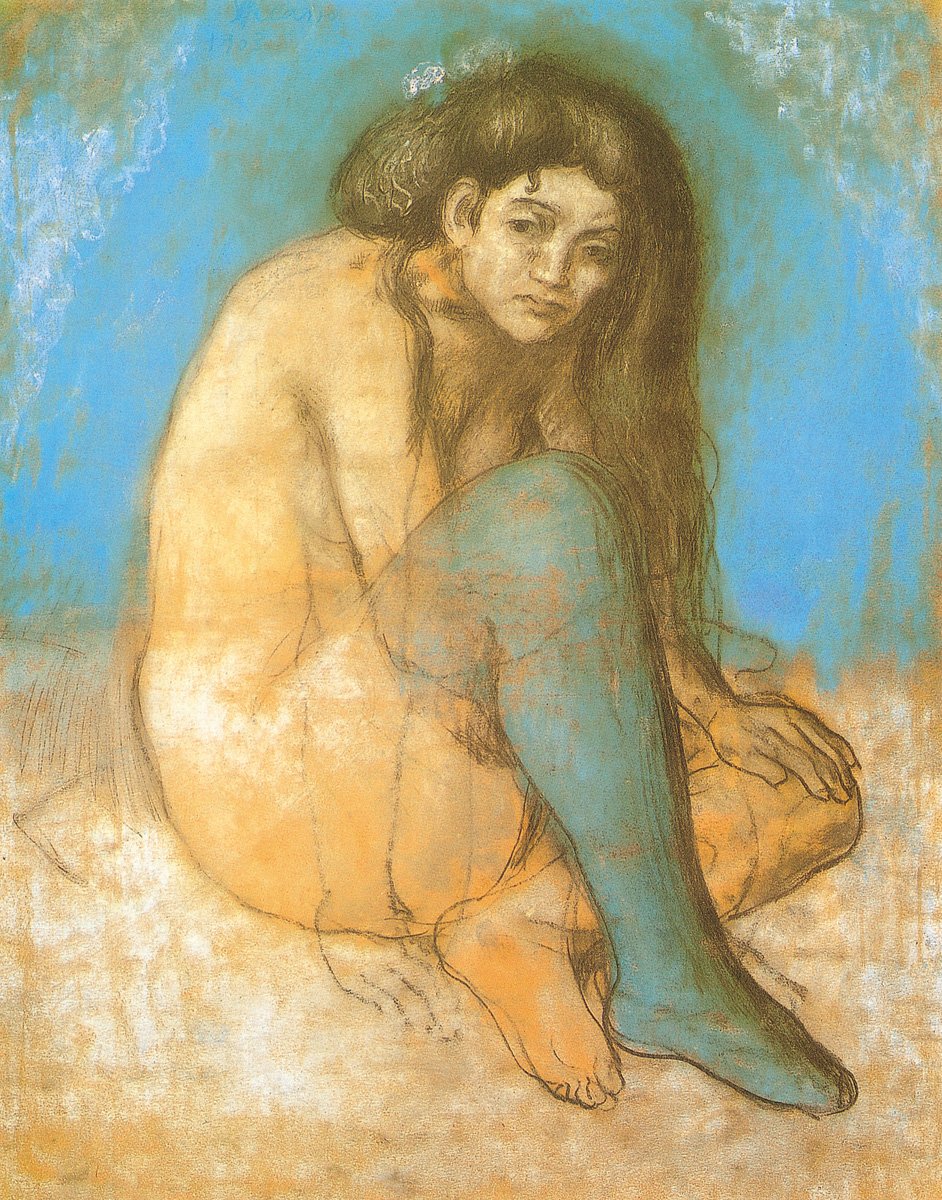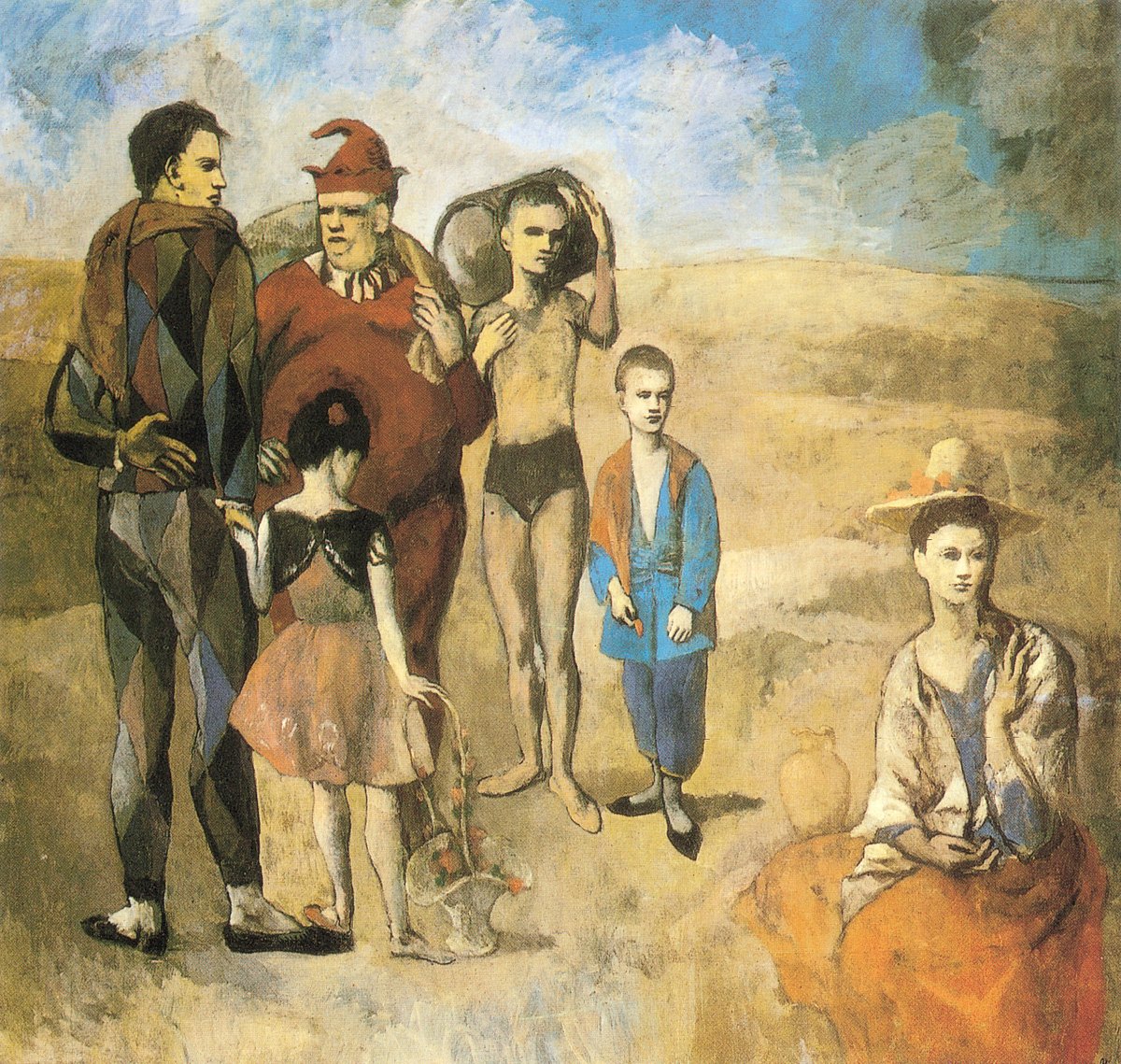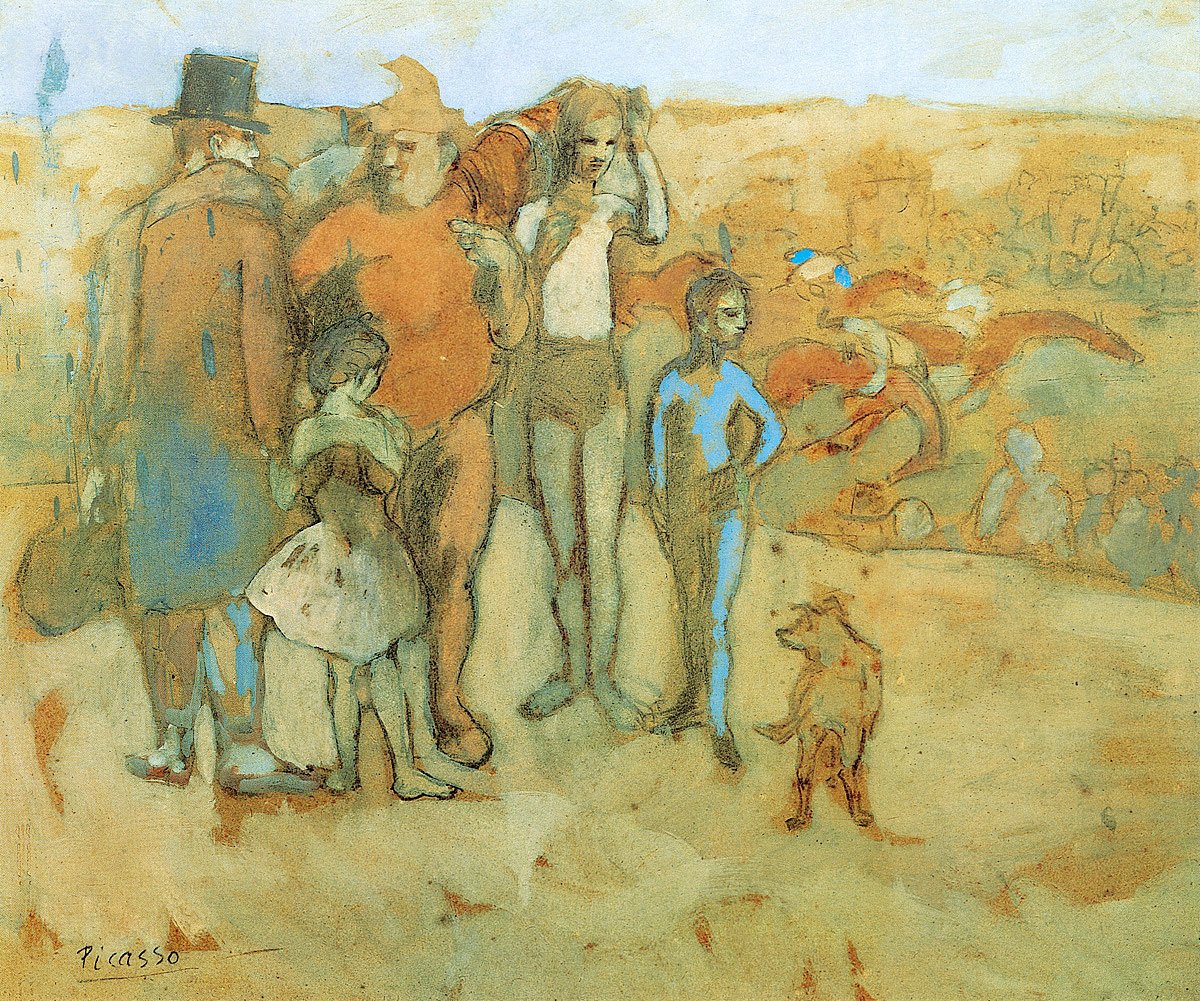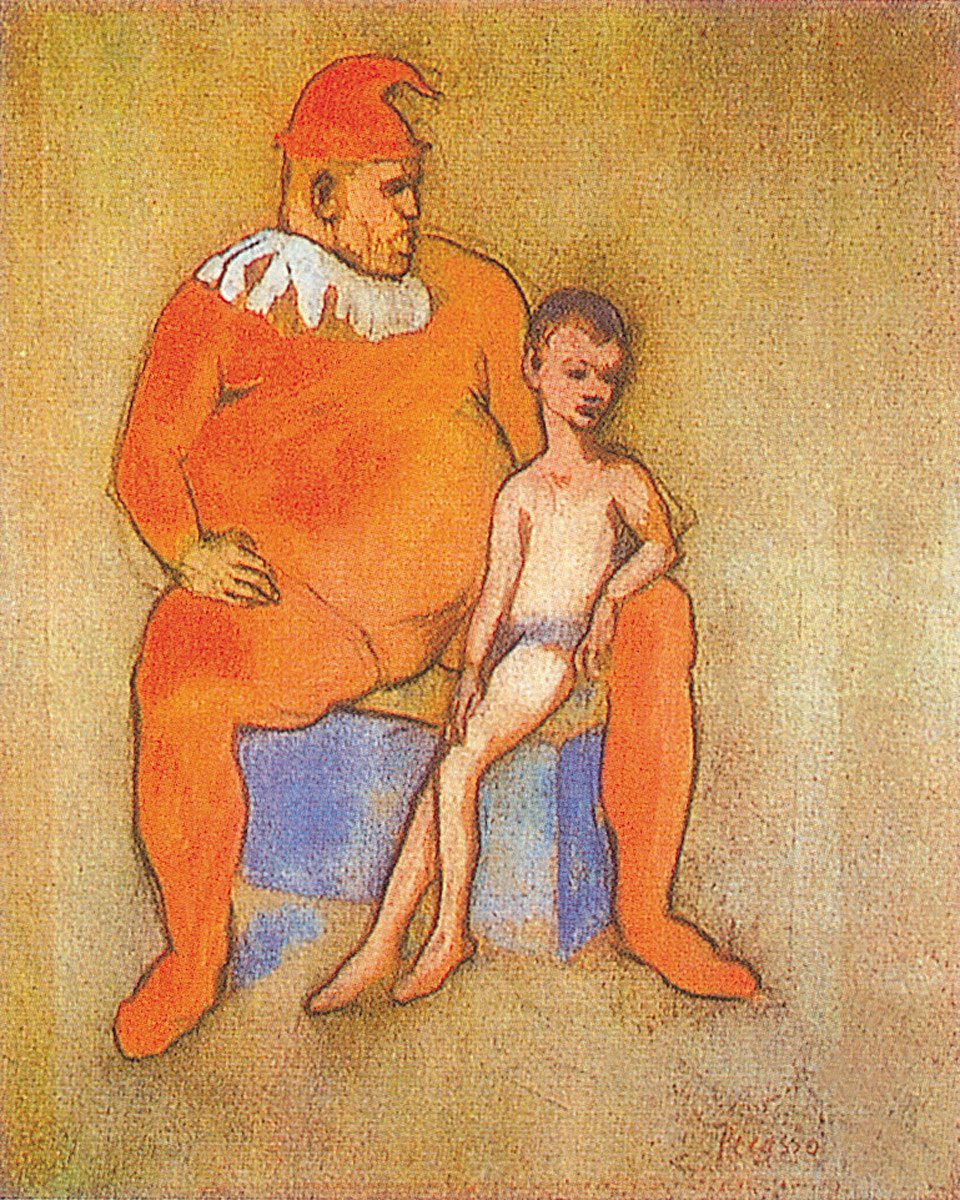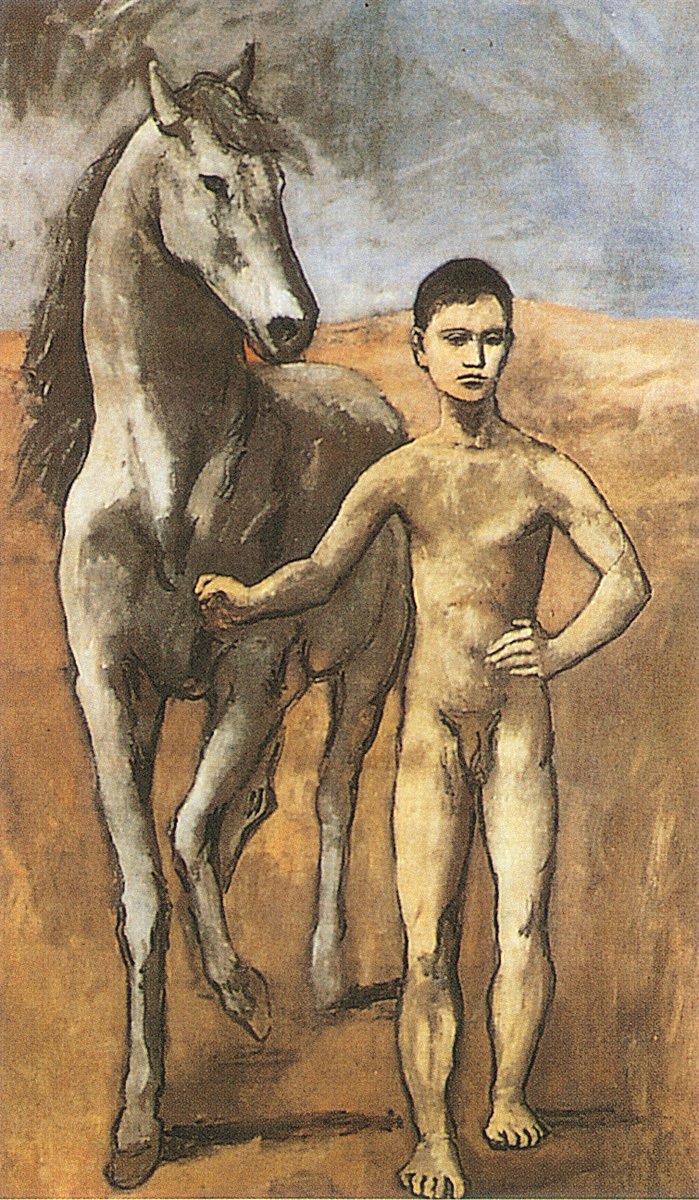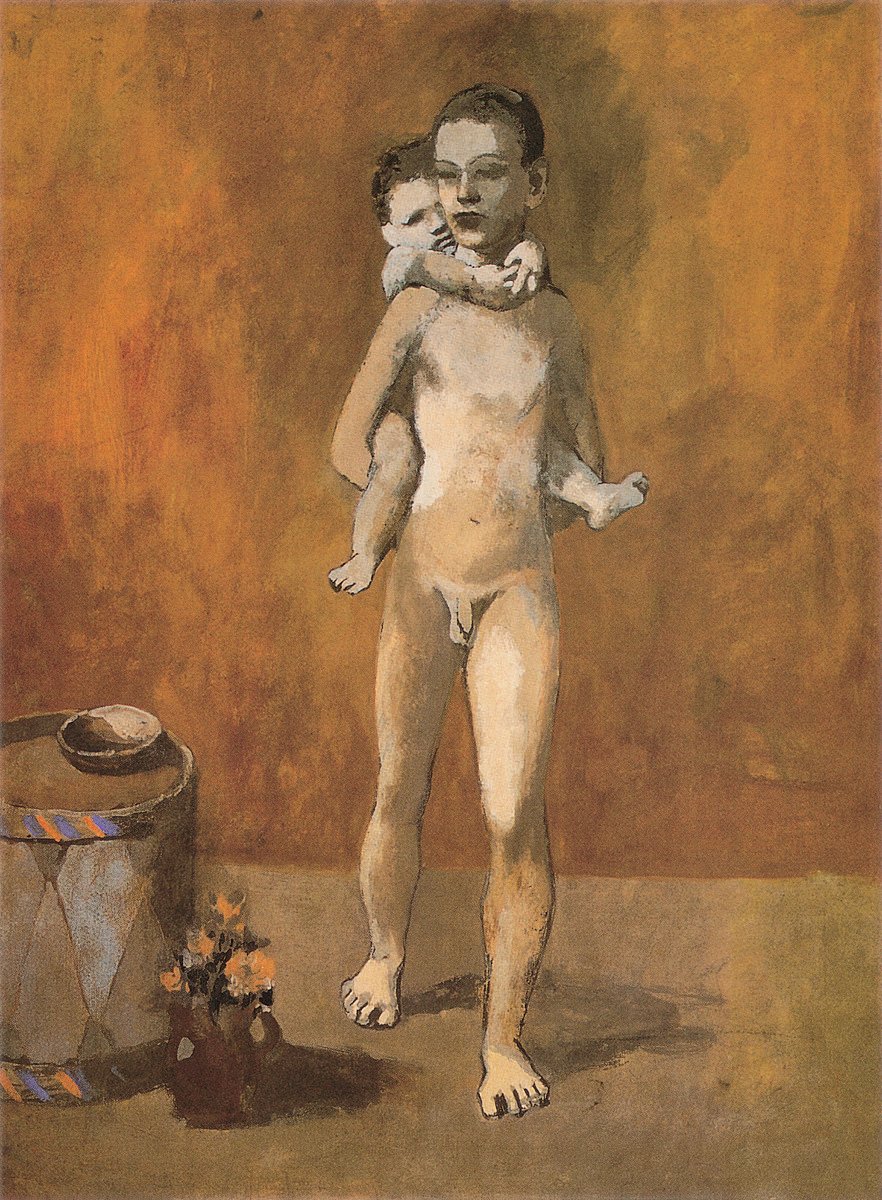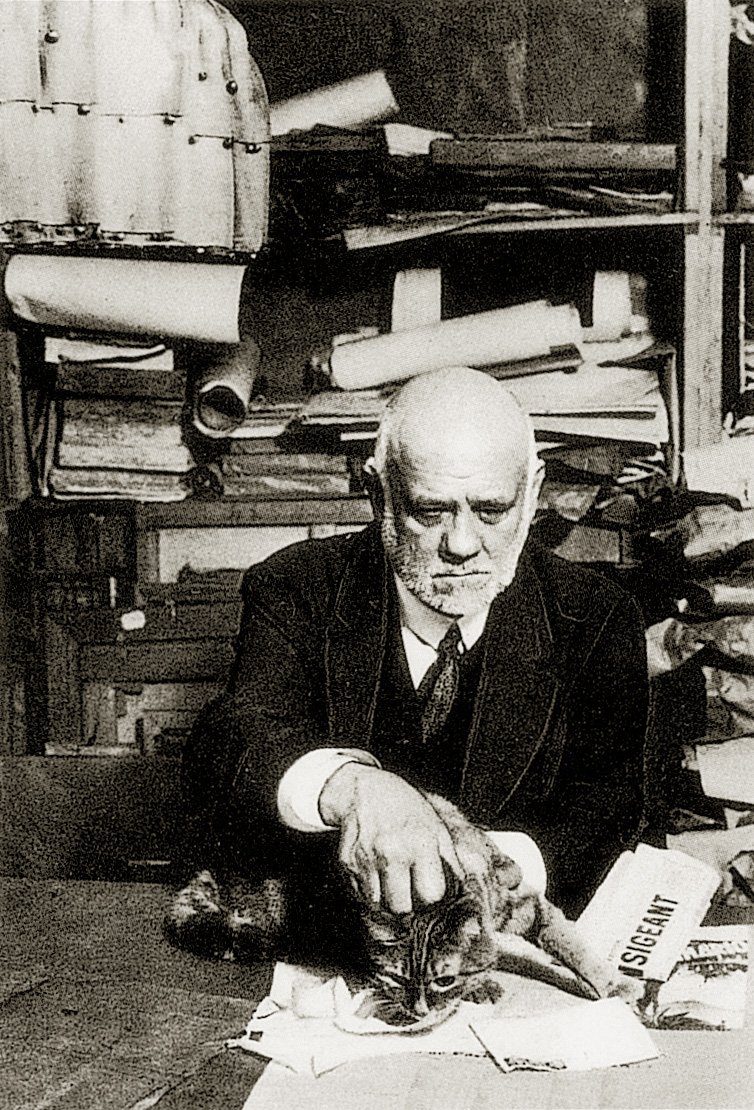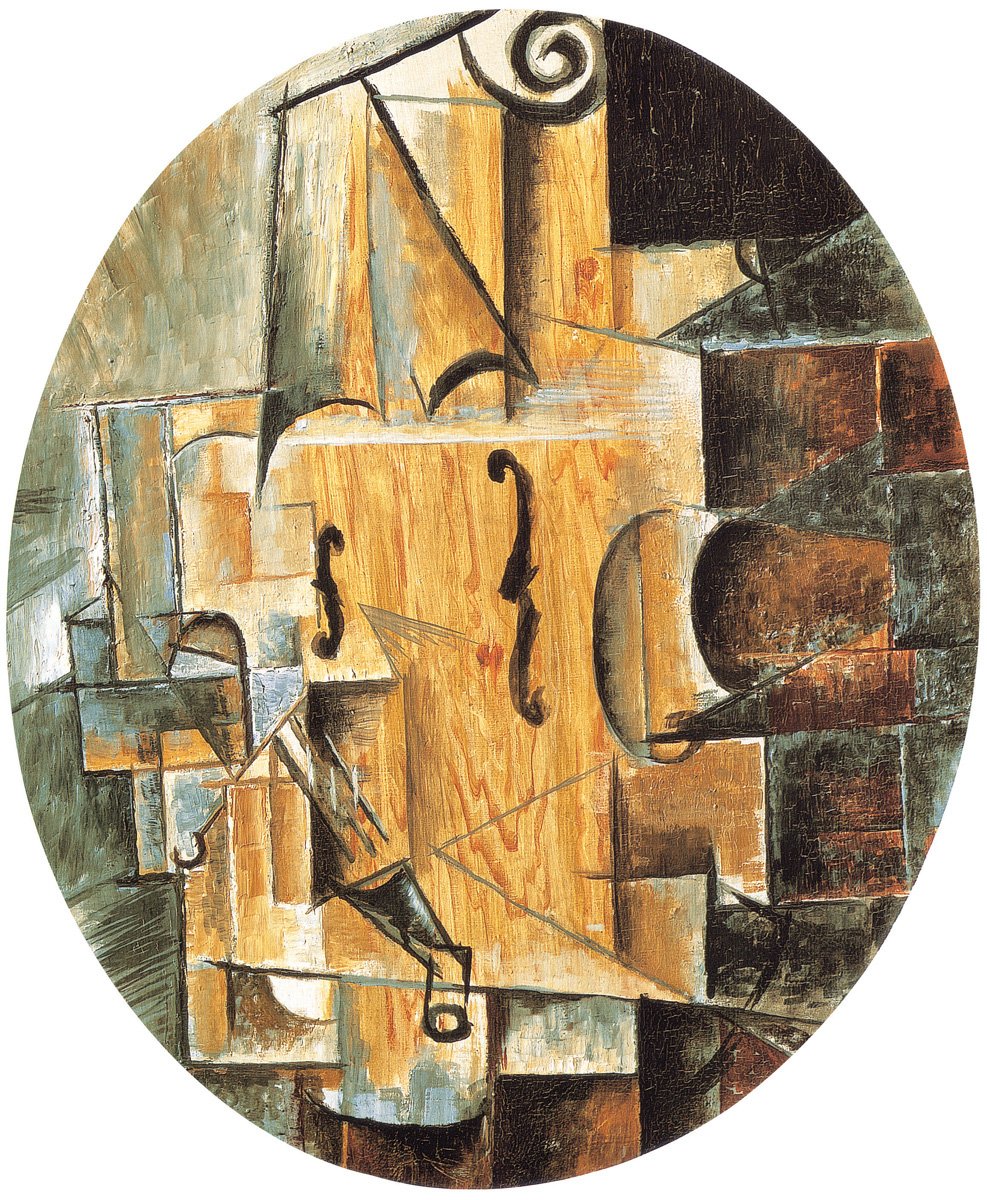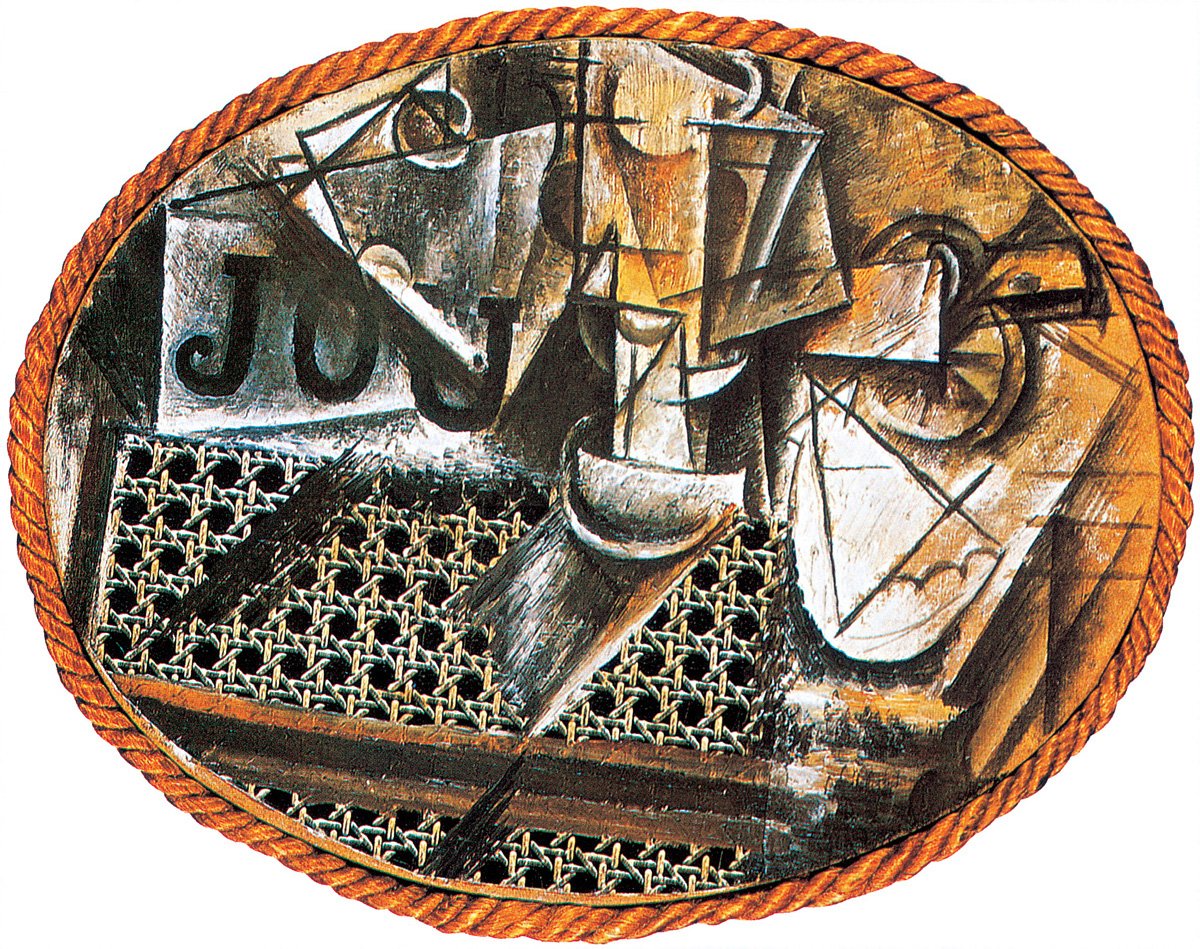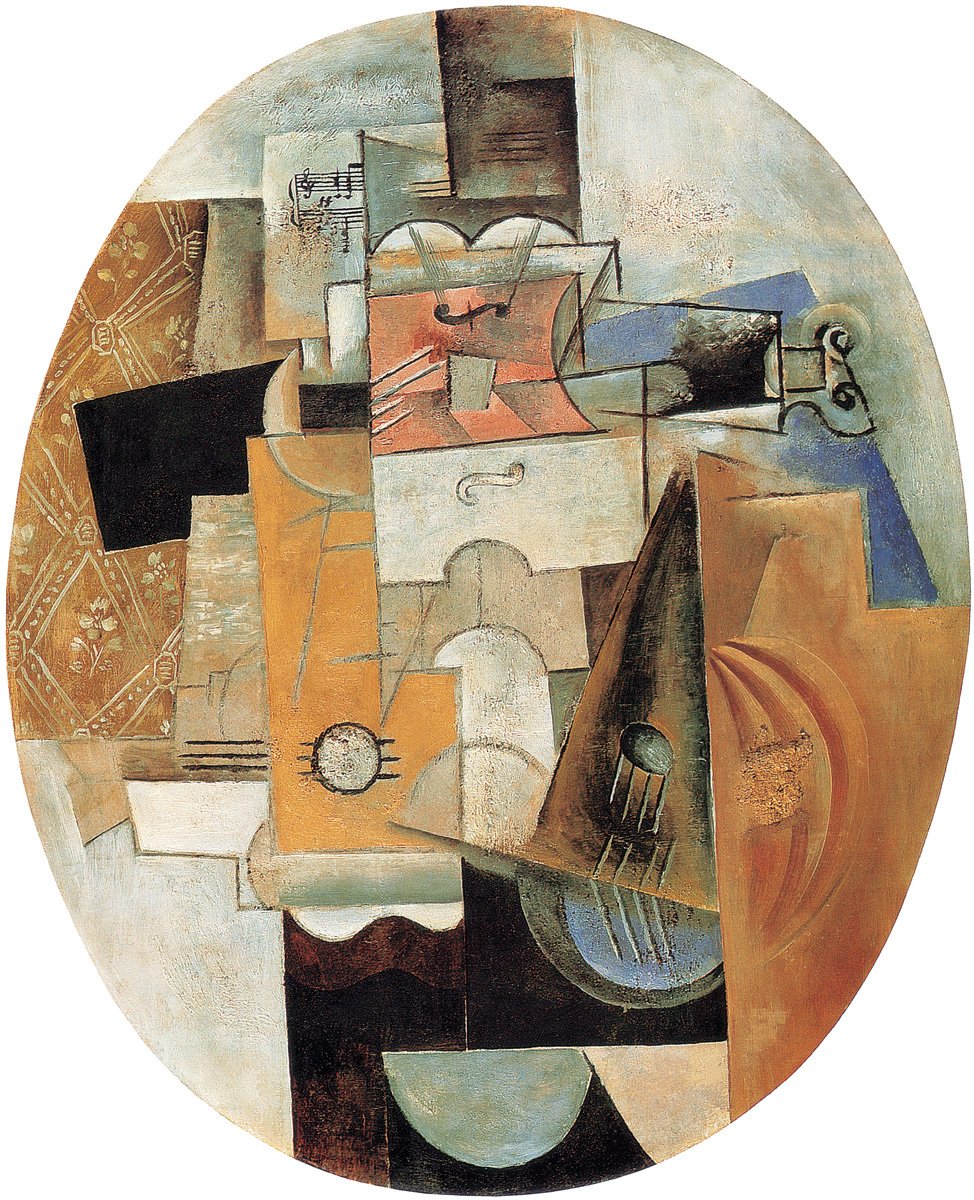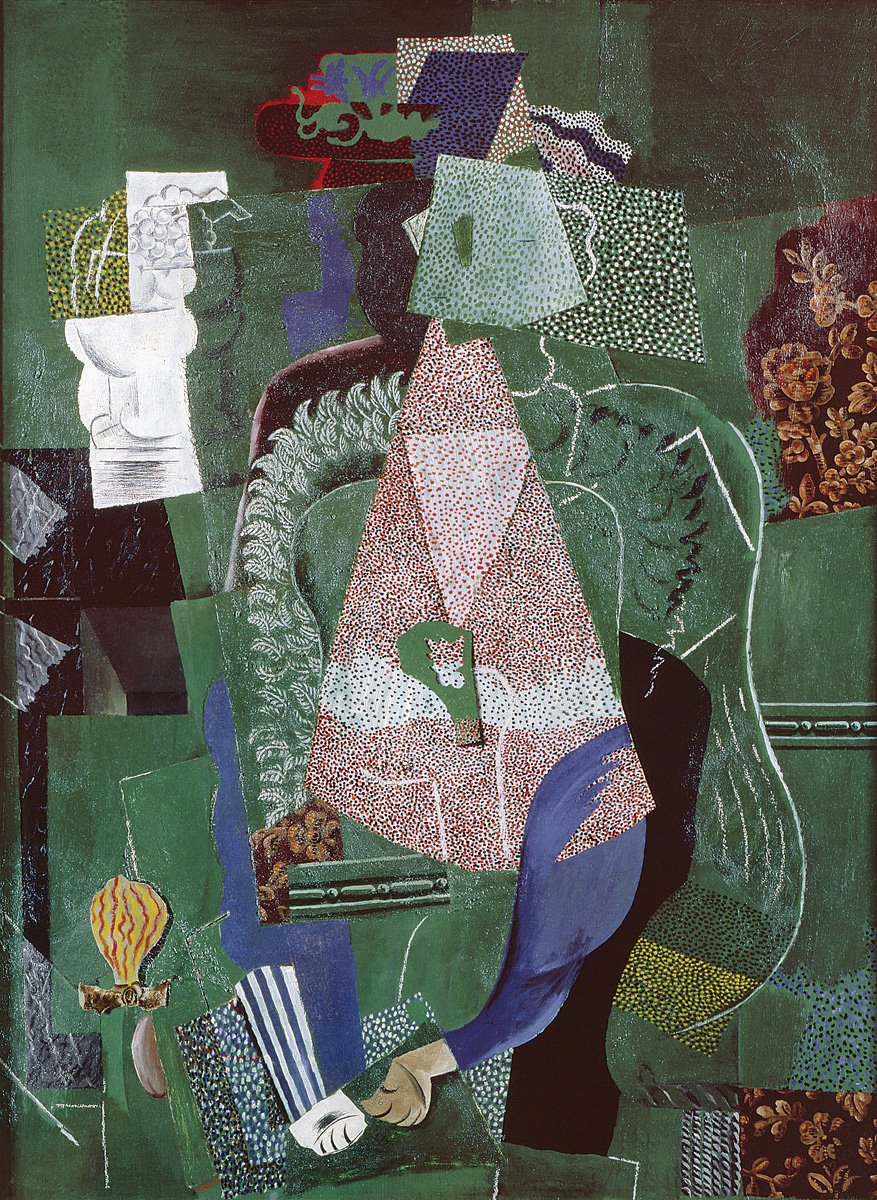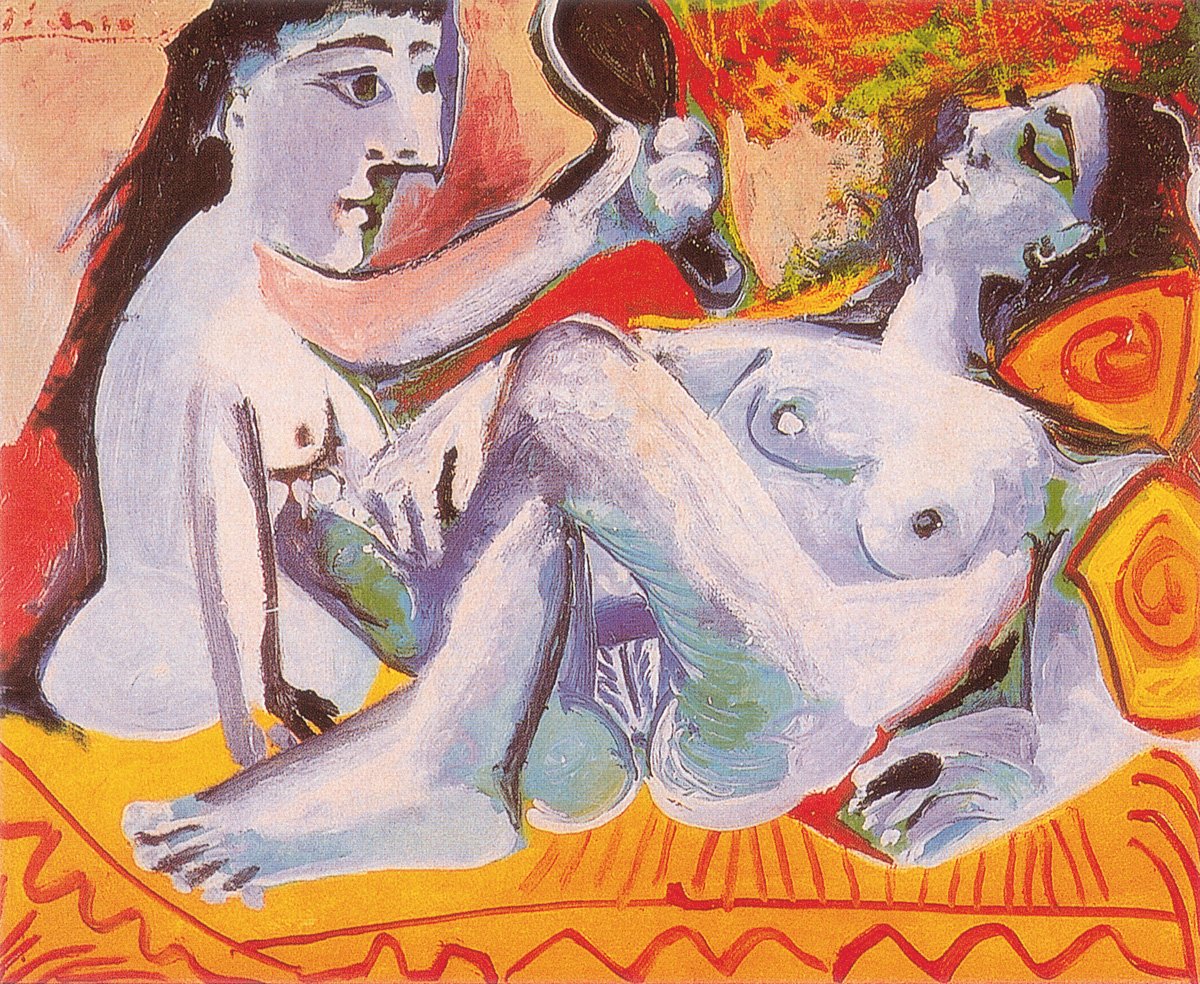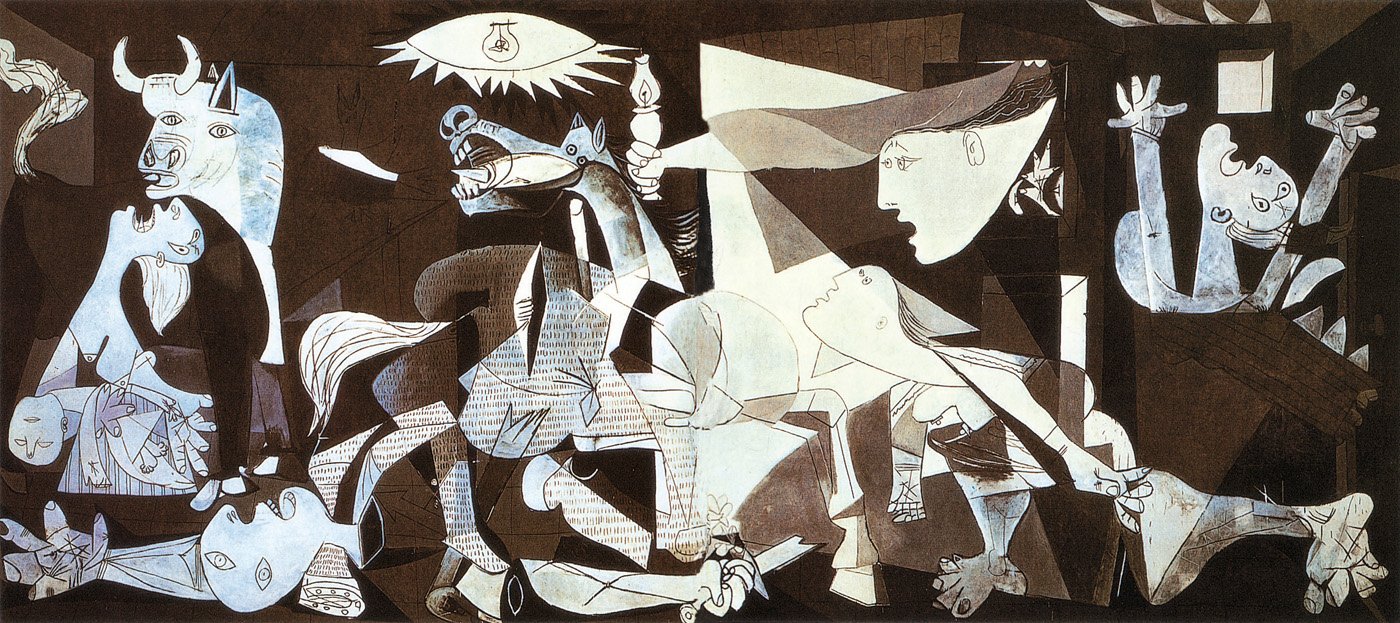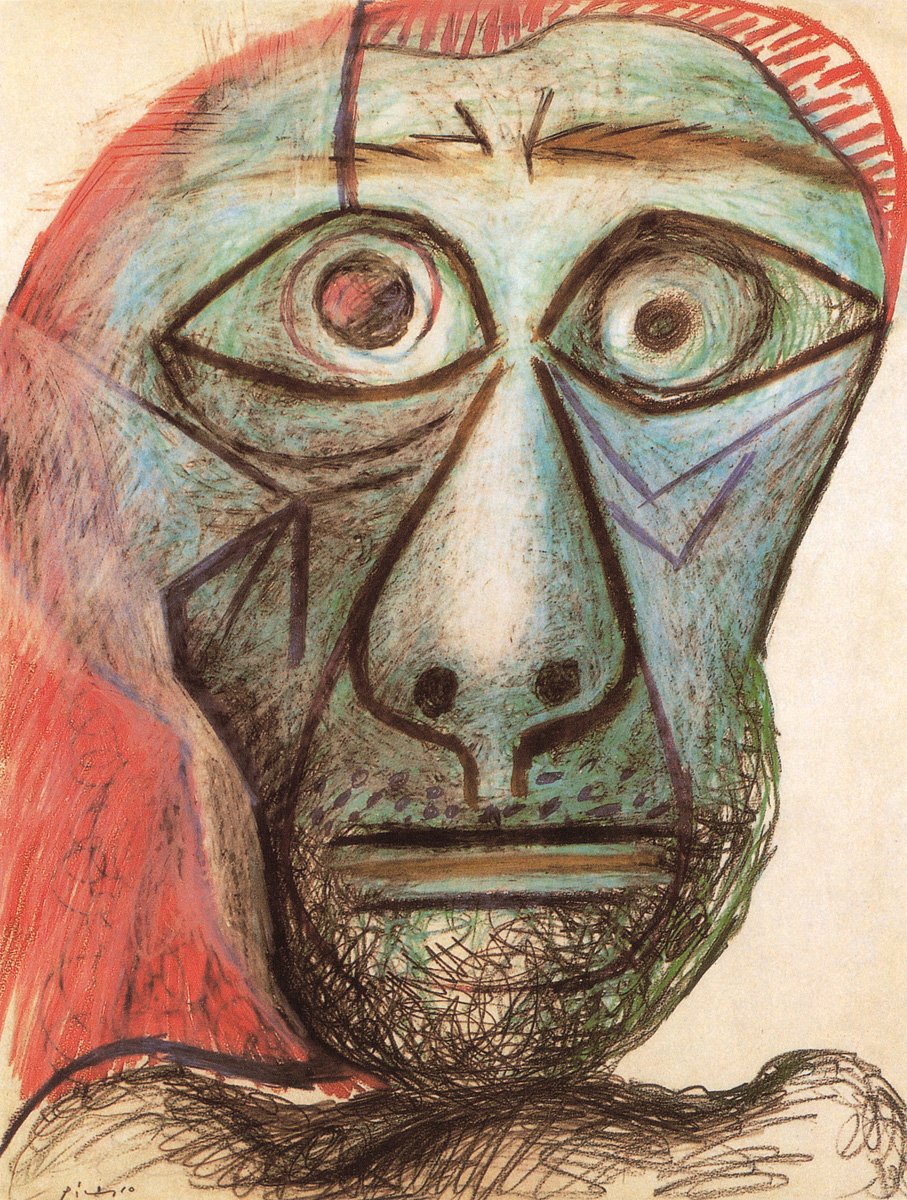Leben und Werk
So ging Raffael vor…, seine große Überlegenheit ist die Folge eines tiefen inneren Drangs, die Form zerbrechen zu wollen. Die Form in seinen Werken ist, was sie auch bei uns ist, sie dient der Vermittlung von Ideen, Empfindungen: eine weitreichende Poesie. Balzac. Das unbekannte Meisterwerk. Obwohl Picasso von Kindheit an das Leben eines Malers führte, wie er selbst es nannte, und obwohl er sich im Laufe von achtzig Jahren ununterbrochen in den Bildenden Künsten ausdrückte, unterscheidet er sich dem Wesen seines schöpferischen Genies nach von dem, was man gewöhnlich unter einem Künstler-Maler versteht. Es wäre vielleicht am richtigsten, ihn als Maler-Dichter zu betrachten, weil die lyrische Stimmung, das von der Alltäglichkeit befreite Bewusstsein und die Gabe der metaphorischen Verwandlung der Realität seinem plastischen Sehen durchaus nicht weniger eigen sind als dem bildhaften Denken des Dichters. Picasso, nach dem Zeugnis von Pierre Daix, „empfand sich selbst als Poeten, der dazu neigte, sich in Zeichnungen, Gemälden und Skulpturen zu äußern“.[1] Empfand er sich immer so? Hier ist eine Präzisierung nötig. Ganz bestimmt in den dreißiger Jahren, als er sich dem Verfassen von Versen zuwandte und dann in den vierziger und fünfziger Jahren sogar Bühnenstücke schrieb. Es besteht kein Zweifel, dass Picasso immer, von Anfang an, „Maler unter Dichtern, Dichter unter Malern war“.[2]
Picasso empfand einen starken Hang zur Poesie und war so auch selbst für die Dichter anziehend. Guillaume Apollinaire war bei ihrer Bekanntschaft erstaunt, wie genau der junge Spanier die Qualität rezitierter Gedichte „über die lexikalische Barriere“ hinaus erfühlte. Ohne Übertreibung kann man sagen, dass die Nähe zu Dichtern wie Max Jacob, Guillaume Apollinaire, André Salmon, Jean Cocteau, Paul Eluard ihre Spuren in jeder wesentlichen Periode seines Schaffens hinterließ, und das Schaffen Picassos selbst stellte sich wiederum als eine einflussreiche Kraft in der französischen und nicht nur der französischen Dichtung des 20. Jahrhunderts dar.
Die Kunst Picassos, die visuell so unverkennbar und manchmal verwirrend dunkel und rätselhaft ist, auch als dichterische Schöpfung zu begreifen, dazu fordert die Einstellung des Künstlers selber auf. Er sagte: „Diese Künste sind schließlich dasselbe; du kannst ein Bild mit Worten genauso schreiben, wie du deine Empfindungen im Gedicht malen kannst.“[3] Er hatte sogar solch einen Gedanken: „Wäre ich als Chinese zur Welt gekommen, so wäre ich nicht Maler, sondern Schriftsteller geworden. Ich hätte meine Bilder in Worten gemalt.“[4]
Picasso aber kam als Spanier zur Welt und begann, wie man sagt, früher zu malen als zu sprechen. Bereits als kleines Kind empfand er einen unbewussten Trieb zu den Utensilien der Maler. Stundenlang konnte er in glücklicher Versunkenheit auf dem Papier nur ihm verständliche, aber ganz und gar nicht sinnlose Spirallinien ausführen, oder er zeichnete, fern von den spielenden Gleichaltrigen, seine ersten Bilder in den Sand. Eine so frühe Bekundung ließ eine erstaunliche Gabe vorausahnen.
Die allererste, noch wortlose, unbewusste Lebensphase strömt ohne Daten, ohne Fakten dahin, wie im Halbschlaf, körperlichen und sinnlichen Rhythmen gehorchend, die dem menschlichen Organismus eigen sind oder von außen auf ihn einwirken.
Das Pulsieren des Blutes, das Atmen, das Streicheln warmer Hände, das Schaukeln der Wiege, die Intonation der Stimmen bilden ihren Inhalt. Dann erwacht das Gedächtnis, und zwei schwarze Augen folgen den sich bewegenden Gegenständen im Raum, umfangen die gewünschten Dinge, drücken emotionelle Reaktionen aus. Die größere visuelle Wahrnehmungsfähigkeit determiniert bereits die Objekte, nimmt immer neue Formen auf, erfasst immer neue Horizonte. Millionen von visuellen Bildern, die zwar vom Auge wahrgenommen, aber noch nicht verstanden werden, finden Eingang in die innere Weltsicht des Säuglings, um sich mit den immanenten Kräften der Intuition zu berühren, mit den angeborenen Reaktionen der Instinkte und den tief verborgenen Stimmen der Vorahnen.
Der Schock der rein sinnlichen Empfindungen ist besonders im Süden stark, wo die große Kraft des Lichtes bald blendet, bald jede Form mit äußerster Schärfe umreißt. Und die wortlose, noch unerfahrene Empfindung des Kindes, das in dieser Gegend zur Welt kam, reagiert auf diesen Schock mit einer unerklärlichen Melancholie, wie einer Art von irrationaler Sehnsucht nach der Form. So ist die lyrische Stimmung der iberischen Mittelmeerküste, des Landes der nackten Natur, das dramatische „Suchen des Lebens um des Lebens willen“, wie der Kenner dieser Empfindungen, Federico Garcia Lorca, schrieb.[5] Vom Romantismus fehlt hier jede Spur: Unter den klaren, exakten Umrissen gibt es keinen Platz für die Sentimentalität, gibt es nur eine Welt, die ein körperliches Gepräge hat. „Wie alle spanischen Maler bin ich Realist“, wird Picasso später sagen.
Später kommen die Worte zum Kinde, diese Bruchstücke von Rede, Bausteine der Sprache. Worte sind abstrakte Dinge. Sie werden vom Bewusstsein produziert, um die äußere und die innere Welt widerzuspiegeln. Die Worte sind der Phantasie untergeordnet, die ihnen Bilder, Sinn, Bedeutungen anbietet, und das verleiht ihnen gleichsam die Dimensionen der Unendlichkeit. Worte sind Instrument der Erkenntnis und Instrument der Poesie. Aus ihnen wird die zweite, ausgesprochen menschliche Realität der abstrakten Dinge der denkbaren Welt geschaffen. Später, als Picasso mit Dichtern in freundschaftlicher Verbindung steht, entdeckt er, dass für die schöpferische Vorstellungskraft visuelle und sprachliche Ausdrucksmittel einander gleichwertig sind. Er überträgt in seine Arbeit Elemente der poetischen Technik: Vieldeutigkeit der Formen, plastische und Farbenmetaphern, Zitate, Reime, „Wortspielereien“, Paradoxien und andere Tropen, die die vorstellbare Welt eines Menschen transparent werden lassen. Absolute Fülle und vollkommene Freiheit der Gestaltung wird die visuelle Poetik Picassos Mitte der dreißiger Jahre erreichen in den Folgen der Bilder mit Frauenaktmodellen, Porträts und Interieurs, die mit „singenden“ und „duftenden“ Farben gemalt sind, und besonders in einer Vielzahl von Tuschzeichnungen, die gleichsam mit einem Hauch auf das Papier gebracht sind.
„Wir sind keine einfachen Ausführer; wir durchleben unsere Arbeit.“[6] Diese Worte Picassos drücken die enge Abhängigkeit seines Schaffens von seinem Leben aus; hinsichtlich seiner Arbeit gebrauchte er auch das Wort „Tagebuch“. Daniel-Henry Kahnweiler, der Picasso mehr als 65 Jahre kannte, schrieb: „Es ist wahr, dass ich sein Schaffen als fanatisch autobiographisch bezeichnet habe. Das ist dasselbe, wie wenn man sagt, dass er nur von sich selbst abhängig war, von seinem eigenen Erlebnis. Er war immer in der Freiheit, niemandem verpflichtet als sich selbst.“[7] Auf die volle Unabhängigkeit Picassos von den äußeren Bedingungen und Umständen beharrte auch Jaime Sabartés, der ihn das ganze Leben kannte.
In der Tat weist alles darauf hin, dass, wenn Picasso in seiner Kunst von etwas abhängig war, so nur von seinem unabänderlichen Bedürfnis, sich mit der ganzen Fülle seines Geistes auszudrücken. Man kann, wie Sabartés, die schöpferische Arbeit Picassos mit einer Therapie vergleichen, man kann, wie Kahnweiler, Picasso als einen Maler der romantischen Schule betrachten, aber gerade das Bedürfnis der Selbstentfaltung durch das Schaffen — als Gewähr für Selbsterkenntnis — verlieh seiner Kunst die Universalität, über die allein solche menschliche Dokumente verfügen, wie etwa Les Confessions von Rousseau, die Leiden des jungen Werther von Goethe oder Une Saison en enfer von Rimbaud. Es ist bemerkenswert, dass Picasso selbst, wenn er seine Kunst von dieser Seite aus betrachtete, den Gedanken äußerte, dass seine Werke, die er sorgfältig datierte, und bei deren Katalogisierung er behilflich war, als dokumentarische Materialien dienen könnten für eine künftige Wissenschaft vom Menschen, wie er sie sich vorstellte. „Sie wird“, sagte Picasso, „danach streben, das Wesen des Menschen an sich durch das Studium des schöpferischen Menschen zu erforschen.“[8] Übrigens bildete sich in Bezug auf das Schaffen Picassos seit langem eine Art wissenschaftliche Auffassung heraus: Man periodisierte ihn, man strebte danach, ihn durch die schöpferischen Kontakte (so genannte Einflüsse, mitunter rein hypothetische) zu erklären, aber auch durch die Widerspiegelung biographischer Ereignisse (vor einiger Zeit erschien ein Buch mit dem Titel Picasso: Kunst als Autobiographie[9]). Wenn für uns das Schaffen Picassos die allgemeine Bedeutung einer universellen menschlichen Erfahrung hat, so deswegen, weil es die innere Welt einer Persönlichkeit in ihrer Entwicklung mit einer seltenen Adäquatheit und mit erschöpfender Fülle gestaltet hat. Nur wenn man sein Schaffen von dieser Position her betrachtet, kann man hoffen, seine Gesetzmäßigkeiten, die Logik seiner Entwicklung, den Wechsel der so genannten Perioden zu verstehen.
Porträt des Vaters des Künstlers, 1896. Öl auf Leinwand und Karton, 42,3 x 30,8 cm. Museo Picasso, Barcelona.
Porträt der Mutter des Künstlers, 1896. Wasserfarbe auf Papier, 19,5 x 12 cm. Museo Picasso, Barcelona.
Die in diesem Album vorgelegten Werke Picassos aus den russischen Museen — die Sammlung wird vollständig veröffentlicht — umfassen die frühen Perioden seines Schaffens, die nach ihren stilistischen (seltener nach thematischen) Erwägungen als Perioden klassifiziert werden: Steinlener (oder Lautrecer), Vitragen, Blaue, Zirkus-, Rosa, klassische, Negro-, protokubistische, kubistische (analytische und synthetische). Die Definition könnte noch mehr detailliert werden. Vom Standpunkt der „Wissenschaft vom Menschen“ aus jedoch war die Zeit, in die alle diese Perioden fallen — zwischen 1900 und 1914, Picasso war im Alter zwischen 19 und 33 —, die Zeit der Entwicklung seiner außergewöhnlichen Persönlichkeit und ihrer vollen Blüte. Die absolute Bedeutung dieser Etappe des geistig-psychologischen Wachsens einer Persönlichkeit unterliegt keinem Zweifel, denn, wie Goethe sagte, um etwas zu schaffen, muss man etwas sein. Die außerordentliche Vollständigkeit und die chronologische Einheit der sowjetischen Sammlung erlaubt es, die vielleicht am schwersten zugängliche Phase im Schaffen Picassos von der Position der Logik dieses inneren Prozesses in gebührendem Maße zu beleuchten.
Etwa um 1900, zur Entstehungszeit des frühesten unter den Bildern der Sammlung, lagen für Picasso seine spanische Kindheit und die Lehrjahre bereits weit zurück. Dennoch lohnt es sich, einige Schlüsselerlebnisse in seiner Kindheit näher zu betrachten. Zuallererst muss Malaga erwähnt werden, hier hat der am 25. Oktober 1881 geborene Pablo Ruiz, der künftige Picasso, die ersten zehn Jahre seines Lebens verbracht. Obwohl er diese Stadt an der andalusischen Küste des Mittelmeeres nie dargestellt hat, war gerade Malaga die Wiege seines Geistes, die Landschaft seiner Kindheit, in der viele Themen und Bilder seines reifen Schaffens wurzeln. Im Stadtmuseum von Malaga sah er zum ersten Mal den antiken Herkules und auf der Placa de Toros Stierkämpfe, und zuhause die gurrenden Tauben, die seinem Vater, dem „Maler von Bildern für Esszimmer“, wie er ihn später selbst nannte, als Modell dienten. Picasso zeichnet das alles, und mit etwa acht Jahren nimmt er bereits Pinsel und Ölfarben in die Hand, um eine Corrida darzustellen. Der Vater erlaubt ihm, auf seinen Taubenbildern die Vogelfüße zu zeichnen, denn Pablo macht das gut und kennerhaft. Und als die Zeit gekommen war, die Schule zu besuchen, wollte er sich auf keinen Fall von seiner Lieblingstaube trennen: Er kam in die Klasse und stellte den Käfig mit dem Vogel auf die Bank… Die Schule als den Ort, wo man sich unterzuordnen hatte, hasste Pablo vom ersten Tag an und widersetzte sich ihr. Auch in Zukunft wird er gegen alles Einspruch erheben, was nach Schule riecht, was sich an der Eigenart und der individuellen Freiheit vergreift, allgemeine Regeln vorschreibt, Normen bestimmt und Auffassungen aufdrängt. Er wird sich nie vorgegebenen Bedingungen anpassen, seinen Überzeugungen abtrünnig werden oder, um es in psychologischen Begriffen auszudrücken, das Lustprinzip dem Realitätsprinzip unterordnen.
Gut ging es der Familie Ruiz-Picasso nie, und unter dem Druck der finanziellen Umstände übersiedelte sie nach Coruña, wo der Vater Picassos die Stelle eines Mal- und Zeichenlehrers im Stadtgymnasium erhielt. Malaga mit seinem milden Klima und seiner üppigen Natur, „lichter Stern im Himmel des mauretanischen Andalusiens, Osten ohne Gift, Westen ohne Tätigkeit“ (wie es bei Lorca heißt), und Coruña, am anderen, nördlichen Ende der Iberischen Halbinsel, mit dem stürmischen Atlantik, dem Regen und den Nebelschwaden… Diese zwei Städte sind nicht nur geographische, sondern auch psychologische Pole Spaniens. Für Picasso waren sie Lebensstationen: Malaga — die Wiege, Coruña — der Abfahrtshafen.
Im Jahre 1891, als die Familie Ruiz-Picasso mit dem zehnjährigen Pablo nach Coruña übersiedelte, herrschte dort noch eine Atmosphäre tiefer Provinz, nicht vergleichbar mit Malaga, wo es einen Kreis von ortsansässigen Malern gab, zu dem auch Picassos Vater gehörte. Dennoch gab es in Coruña eine Schule der freien Künste, wo der junge Pablo Ruiz, als er sich systematisch mit Zeichnen zu befassen begann, unwahrscheinlich schnell (mit 13 Jahren) das akademische Programm des Zeichnens nach dem Gips und der lebendigen Natur durchlief. In diesen Studien setzt nicht nur die in diesem nachahmenden Studium notwendige und phänomenale Exaktheit und Genauigkeit der Ausführung in Erstaunen, sondern auch die von dem jungen Maler in diese trockene Materie hereingebrachte Lebendigkeit des Helldunkels, die die Gipstorsos, Hände und Füße in lebendige und geheimnisvolle poetische Bilder verwandelt.
Aber er zeichnet nicht nur in der Klasse, sondern auch zu Hause, zeichnet die ganze Zeit, egal worauf. Das sind Bildnisse von der Familie, Alltagsszenen, romantische Sujets, Tiere.
In Nachahmung der periodischen Druckschriften jener Zeit gibt er seine eigenen Zeitschriften heraus — Coruña und Azul y Blanco — mit handschriftlichem Text und humoristischen Illustrationen. Angemerkt sei hier, dass die Zeichnungen des kleinen Picasso erzählerischen Charakter und eine „Dramaturgie“ besitzen, dass das Bild und das Wort für ihn beinah gleichwertig sind; diese beiden Momente sind bedeutsam in der Perspektive der künftigen Entwicklung der Kunst Picassos.
Zuhause unter der Leitung des Vaters — der Vater war so von den Erfolgen des Sohnes beeindruckt, dass er ihm seine Palette mit den Pinseln und Farben übergeben hatte — begann Pablo im letzten Jahr seines Verbleibens in Coruña nach lebenden Modellen in Öl zu malen (Ein Armer, Mann mit Mütze). Diese ohne jeden Akademismus gemalten Bildnisse und Figuren offenbaren nicht nur die frühe Reife des dreizehn-, vierzehnjährigen Malers, sondern auch die zutiefst spanische Herkunft seines Talents: Sein ganzes Interesse konzentriert sich auf den Menschen; das Modell ist mit einem tiefen Ernst und rauem Realismus behandelt, wodurch die Bedeutsamkeit, Einheitlichkeit, das „Kubistische“ dieser Gestalten zutage tritt. Sie sind nicht in dem Maße Lehrarbeiten, sondern eher psychologische Porträts, und wiederum weniger Porträts als allgemein menschliche Charaktere, wie etwa die biblischen Figuren Zurbarans und Riberas.
Nach dem Zeugnis von Kahnweiler äußerte sich Picasso in den späteren Jahren über diese seine malerischen Debüts beifälliger als über die Bilder, die er in Barcelona gemalt hatte, wohin die Familie Ruiz-Picasso im Herbst 1895 übersiedelte und wo Pablo sofort Student der Malereiklasse der Schule der schönen Künste La Lonja wurde. In der Tat konnte der Besuch der akademischen Klassen in Barcelona nach den ersten Meisterwerken von Coruña nichts mehr zur Entfaltung der originellen Gabe des jungen Picasso beitragen, der die Handgriffe des malerischen Gewerbes selbständig vervollkommnen konnte.
Aber der offizielle Weg, Maler zu werden, schien damals der einzige zu sein, und um den Vater nicht zu betrüben, blieb er noch zwei ganze Jahre Student von La Lonja und konnte natürlich nicht vermeiden, für eine Zeit unter den nivellierenden Einfluss des Akademismus zu geraten, der von der offiziellen Schule zusammen mit den Berufsfertigkeiten eingeimpft wurde. „…Meine Studienzeit in Barcelona — welch Abscheu empfinde ich gegen sie!“ gestand Picasso Kahnweiler.[10]
Und doch brachte die für ihn vom Vater gemietete Werkstatt (mit 14 Jahren!), die ihm eine verhältnismäßige Emanzipation sowohl von der Schule als auch von dem engen Kreis der Familie erlaubte, eine reelle Unterstützung seiner Selbständigkeit. „Ein Studio ist für einen jungen Mann, der mit überschäumendem Ungestüm seine Berufung fühlt“, schreibt Josep Palau i Fabre, „fast wie eine erste Liebe: Alle Illusionen zentrieren und kristallisieren sich dort.“[11] Und hier zog Picasso die Bilanz seiner Schuljahre, indem er die ersten großen Gemälde malte: Die erste hl. Kommunion (Winter 1895-1896) — eine Komposition im Interieur mit Figuren, Drapierungen und Stillleben, mit schönen Lichteffekten — und Ciencia y Caridad (Anfang 1897) — ein riesengroßes Gemälde mit Figuren größer als das Modell, eine Art reale Allegorie. Das letzte erhielt eine Ehrenurkunde auf der nationalen künstlerischen Ausstellung in Madrid und eine Goldmedaille auf der Ausstellung in Malaga.
Betrachtet man die schöpferische Biographie des frühen Picasso in den Begriffen der Erziehungsromane, so eröffnet seine Abreise von Zuhause nach Madrid im Herbst 1897 — offiziell für die Fortsetzung des Studiums an der Königlichen Akademie der Schönen Künste (Academia de San Fernando) — tatsächlich die nach den Lehrjahren nächste Lebensetappe, die der Wanderjahre. Umsiedlungen von Ort zu Ort, ein ständiges Umherirren entsprechen in dieser Periode dem Zustand der inneren Unbestimmtheit, des Bedürfnisses der Selbstbehauptung und des Strebens nach der Unabhängigkeit, mit dem bei dem Jüngling das Werden seiner Persönlichkeit beginnt.
Rendez-vous (Die Umarmung), 1900. Öl auf Karton, 52 x 56 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.
Die Wanderjahre Pablo Picassos sind die aus mehreren sich abwechselnden Phasen gebildete siebenjährige Periode seines Lebens zwischen 16 und 23, zwischen der ersten selbständigen Abreise nach Madrid — der künstlerischen Metropole seines Landes — im Jahre 1897 und der endgültigen Niederlassung in Paris — der künstlerischen Metropole der Welt — im Frühjahr 1904.
Wie auch während seines ersten Besuchs im Jahr 1895 auf dem Weg nach Barcelona, bedeutete Madrid für Picasso vor allem das Museum Prado, wo er öfter erschien als in der Academia de San Fernando, um die alten Meister zu kopieren (vor allem zog ihn Velazquez an). Aber, nach der Bemerkung von Sabartés, „die Entwicklung seines Geistes wird von Madrid sehr geringfügig beeinflusst“,[12] und man darf behaupten, dass für Picasso der erlebte schwere Winter 1897/98 und die darauf folgende langwierige Krankheit, die symbolisch das Ende seiner „akademischen Karriere“ bezeichnet, die wichtigsten Ereignisse in der Hauptstadt waren.
Demgegenüber bedeutete Picasso der Aufenthalt in Horta de Ebro in der Nähe einer Siedlung im Hochgebirge Kataloniens, wohin er zur Kur kam und wo er für ganze acht Monate blieb (bis zum Frühjahr 1899), so viel, dass er auch Jahrzehnte später unverändert sagte: „Alles, was ich kann, habe ich in Horta de Ebro gelernt.“[13] Zusammen mit Manuel Pallares, dem ersten Barcelonaer Freund, der ihn auch einlud, bei sich im Elternhaus in Horta zu verweilen, durchstreifte Pablo mit dem Malgerät und dem Skizzenblock alle Gebirgspfade in der Umgebung dieser Kleinstadt, die einen rauen mittelalterlichen Charakter bewahrt hatte. Zusammen mit dem Freund bestieg Picasso die umliegenden Felsen, schlief auf einem Lager aus Lavendel in einer Höhle, wusch sich mit Quellwasser, durchstreifte Bergschluchten unter der Gefahr, in die reißende Strömung eines Bergflusses zu stürzen… Er wollte sich mit der Kraft der Naturgewalten messen und die ewigen Werte des einfachen Lebens mit seinen Mühen und seinen Freuden kennen lernen.
Tatsächlich sind die in Horta verlebten Monate nicht eigentlich durch ihre künstlerische Produktion (erhalten geblieben sind nur einige Studien und Skizzenbücher) bedeutend, sondern durch ihre Schlüsselposition im Werdeprozess der Persönlichkeit des jungen Picasso. Diese an sich kurze biographische Episode ist eines besonderen Kapitels im „Roman der Erziehung“ Picassos würdig, eines Kapitels, in dem es Szenen der bukolischen Abgeschiedenheit im Schoße der unberührten, gewaltigen und lebensspendenden Natur gibt; es gibt da die Empfindung der Freiheit und der Fülle des Seins, es gibt die Idee des Naturmenschen und des Lebens, in harmonischem Rhythmus des zyklischen Jahreszeitenwechsels.
Aber wie es sich für Spanien geziemt, enthält dieses Kapitel auch brutale Momente der Versuchung, Errettung oder Todesringen — die Triebkräfte des Dramas der menschlichen Existenz. Palau i Fabre, der alle Ereignisse dieses ersten Aufenthalts Picassos in Horta beschrieb, bemerkt: „Es scheint mehr als paradox zu sein, beinahe hätte ich gesagt, von der Vorsehung bestimmt, dass Picasso sozusagen in dem Augenblick wiedergeboren wurde, als er Madrid und die Nachahmung der großen Meister der Vergangenheit aufgab, um sich mit den urtümlichen Kräften des Landes zu verbinden…“[14] Man muss hinzufügen, dass der Wert der Erfahrungen, die der halbwüchsige Picasso in Horta de Ebro machte, für die Forscher noch mehrmals von Bedeutung sein wird im Zusammenhang mit dem Problem seiner „Mittelmeerquellen“ und des „iberischen Archaismus“ im entscheidenden Moment seines Werdens, also im Jahr 1906, wie auch im Zusammenhang mit dem erneuten Aufenthalt des Malers in Horta im Jahr 1909, der eine neue Etappe in der künstlerischen Konzeption Picassos — den Kubismus — bezeichnen wird. Nach dem ersten Aufenthalt in Horta de Ebro kehrte Picasso reifer und voll neuer Kräfte nach Barcelona zurück, das er jetzt auch auf andere Weise erlebt — als Sammelpunkt der fortschrittlichen Strömungen, als eine für die Gegenwart offene Stadt. Tatsächlich war die kulturelle Atmosphäre von Barcelona am Vorabend des 20. Jahrhunderts von Optimismus durchtränkt. Vor dem Hintergrund der Aufrufe zur regionalen Wiedergeburt Kataloniens, vor dem Hintergrund des Auftretens der Anarchisten, vor dem Hintergrund der neuesten technischen Errungenschaften (Auto, Elektrizität, Phonograph, Kinematograph, Beton) und der neuesten Ideen der Massenproduktion festigte sich in den jungen Gemütern der Gedanke von einer mit dem neuen Jahrhundert entstehenden, noch nie gesehenen Epoche der Kunstentfaltung.
Gerade in Barcelona, das sich mehr dem zeitgenössischen Europa zuwandte als dem in Lethargie versunkenen, patriarchalischen Spanien, entstand die Kunstströmung „Modernismo“ — die katalanische Abart der kosmopolitischen künstlerischen Tendenzen des „Fin de siècle”, die in sich ein ganzes Spektrum der ideellen und ästhetischen Einflüsse vom skandinavischen Symbolismus bis zum Präraffaelismus, vom „Wagnerismus“ und „Nietzscheanismus“ bis zum französischen Impressionismus und der Stilrichtung der Pariser humoristischen Zeitschriften vereinigte.
Picasso, der noch nicht einmal achtzehn und folglich in einem rebellischen Alter war, wies sowohl die blutarme akademische Ästhetik als auch den lahmen Prosaismus der realistischen Sicht zurück und solidarisierte sich natürlich mit allen, die sich Modernisten nannten, d. h. mit den nichtkonformistisch orientierten Malern, Literaten, mit der „Elite des katalanischen Gedankens“ (nach einem Ausdruck von Sabartés), die sich um das künstlerische Kabarett „Els Quatre Gats“ gruppierte.
Der Untersuchung der Frage, was die Kunst Picassos aus den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts dem Barcelonaer Modernismus zu verdanken hat, wird viel Aufmerksamkeit geschenkt. In dieser Angelegenheit bemerkte Cirlot: „Die Kritiker meinen, es sei sehr nützlich, über die ,Einflüsse‘ zu sprechen, denn da kann man von der Gelegenheit Gebrauch machen, etwas zu erklären, was sie selbst nicht verstehen, durch etwas, das sie verstehen, aber häufig völlig falsch, und das Ergebnis ist deswegen ein unentwirrbares Durcheinander.“[15] Tatsächlich muss man diese Frage aus dem Kreis der Hypothesen über die flüchtigen stilistischen Einflüsse (R. Casas, I. Nonell, G. Anglada Camarasa), unter denen die Vorstellung über das wirkliche, natürliche Element des großen Talents Picassos verwischt wird, eliminieren.
Die Rolle des Barcelonaer Modernismus bestand in der avantgardistischen Erziehung des jungen Picasso, in der Befreiung seines künstlerischen Bewusstseins von den Schulschablonen. Aber diese avantgardistische Universität war gleichzeitig auch die Arena seiner Selbstbehauptung. Picasso, der sich im Jahre 1906 mit einem Tenor vergleichen wird, der eine Note höher nimmt, als es in der Partitur steht,[16] wird wirklich nie von dem unterjocht, was ihn hinreißt; er beginnt jedesmal da, wo der Einfluss endet.
In der Tat imponierte Picasso in diesen Barcelonaer Jahren der graphische „Jargon“ der Pariser Zeitschriften jener Epoche (die Manier Forains, Steinlens, der Zeichner des Gil Blas, La Vie parisienne u. dgl.), zumal er selbst einen ebenso treffenden, scharfen Stil kultivierte, der alles Überflüssige ausschloss und durch das Spiel weniger Linien und Flecken den lebendigen Ausdruck jedweden Charakters jeder Situation erreichte und diese durch die Brille der Ironie betrachtete. Viel später wird Picasso gelegentlich bemerken, dass in der Tat alle guten Porträts Karikaturen sind. In diesen Barcelonaer Jahren zeichnet er mehrere Porträtkarikaturen von seinen Genossen in der Avantgarde, und es scheint geradezu, als strebe er danach, sein Modell zu besiegen, es seinem künstlerischen Willen unterzuordnen, es in eine strenge graphische Formel zu fassen. Wahr ist aber auch, dass in dieser neuen, modernistischen Form dasselbe literarische, erzählerische Moment auftritt, das wir schon in den handgeschriebenen Kinderzeitschriften des kleinen Pablo in Coruña bemerkten.
Harlekin und seine Gefährtin (Zwei Gaukler), 1901. Öl auf Leinwand, 73 x 60 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.
Als eines Gemäldes würdig findet Picasso in den Jahren 1899-1900 nur solche Sujets, in denen die „letzte Wahrheit“, die Vergänglichkeit des Lebens, die Unvermeidlichkeit des Todes durchscheint. Die Zeremonie des Abschieds von einem Entschlafenen, Wachen am Sarg, Agonie eines Invaliden am Sterbebett im Krankenhaus, Szene im Zimmer eines Verstorbenen oder am Bett einer Sterbenden: der nichtsnutzige Gatte tut Abbitte… ein Geiger spielt… ein vergrämter langhaariger Dichter… der Liebhaber auf Knien… ein junger Mönch beim Gebet. In solchen Variationen arbeitete Picasso dieses Thema aus (im Barcelonaer Picasso-Museum werden nicht weniger als 25 graphische und 5 malerische Skizzen aufbewahrt). Schließlich malte er eine große (ca. 130 x 220 cm) Komposition Derniers moments (Letzte Augenblicke), die Anfang 1900 in Barcelona gezeigt wurde, dann in demselben Jahr auf der Weltausstellung in Paris.
Danach verschwand das Bild unter der Malschicht des bekannten Gemäldes der Blauen Periode La Vie; es wurde erst vor kurzem bei einer Untersuchung mit Röntgenstrahlen wiederentdeckt.[17] Alles in den Derniers Moments war grüblerisch: der morbide Symbolismus wie auch die Figuren (der junge Priester am Bett der Sterbenden) und sogar die Stilistik, die Picassos Begeisterung für die „spirituelle“ Malerei El Grecos widerspiegelte, der als Stammvater der antiakademischen modernistischen Tradition empfunden wurde. Alles in diesem Bild gehörte Picasso nur in dem Maße, in dem er selbst jener Epoche zugehörte, der Epoche von Maeterlinck, Munch, Ibsen, Carrière. Es ist auch kein Zufall, dass die symbolische Arbeit Derniers Moments so stark an die Schularbeit Ciencia y Caridad erinnert, denn trotz der verstärkten altersbedingten Hinwendung zum Todesthema, ihrer beinahe dekadenten Gestaltung, wie auch in mehreren anderen Arbeiten Picassos im Strom des katalanischen Modernismo, erweckt sie den Eindruck einer abstrakten Studie. Picasso war die Dekadenz fremd, und er betrachtete sie mit Ironie als Äußerung von Schwäche, von Leblosigkeit. Er erschöpfte sehr rasch alle Möglichkeiten des Modernismo und geriet danach in eine Sackgasse.
Paris rettete ihn, und nach mehreren Monaten (im Sommer 1902) wird er an seinen ersten französischen Freund, Max Jacob, von seinem Gefühl der Isolierung unter den Freunden in Barcelona schreiben, von „den hiesigen Malern“ (wie er in seinem Brief skeptisch betont), die „sehr schlechte Bücher verfassen“ und „dumme Bilder“ malen.[18]
Im Oktober 1900 kam Picasso nach Paris, ließ sich auf den Höhen von Montmartre nieder und blieb dort bis zum Ende des Jahres. Obwohl seine Kontakte auf die Kolonie der Landsleute begrenzt bleiben und er die Umgebung mit der Neugier eines Fremden betrachtet, findet Picasso sofort und ohne Zögern sein Thema. Er wird ein Maler des Montmartre.
Mit dem Datum seines 19. Geburtstags (25. Oktober 1900), einige Tage nach seiner Ankunft in Paris, ist jener Brief datiert, der den Verlauf des Pariser Lebens Picassos und seines unzertrennlichen Freundes, dem Maler und Dichter Carlos Casagemas, dokumentiert; sie berichten einem Freund in Barcelona von der intensiven Arbeit, von ihren Plänen, Bilder im Pariser Salon und in Spanien auszustellen, von den abendlichen Besuchen der Cafékonzerte und Theater, beschreiben Treffen, Schauspiele, ihre Wohnung. Der Brief verströmt jugendlichen Optimismus und gibt ihren begeisterten Eindruck vom Leben wieder („Falls Du Opisso siehst, so sage ihm, er solle kommen, zum Wohl der Seelenrettung, sag ihm, er soll Gaudi und die Sagrada Familia zum Teufel schicken… Hier sind überall echte Lehrer“.)[19] Die umfangreichen Abteilungen der Weltausstellung (in der spanischen Sektion unter der Nummer 79 heißt es: Pablo Ruiz-Picasso, Derniers moments); die Retrospektive „Hundert und zehn Jahre der französischen Kunst“ mit den Gemälden von Ingres und Delacroix, Courbet und den Impressionisten bis zu Cézanne; der gewaltige Louvre mit den endlosen Sälen der Meisterwerke der Malerei und Skulptur alter Zivilisationen; ganze Straßen von Galerien und Geschäften, in denen die neue Malerei ausgestellt und verkauft wird. „Mehr als sechzig Jahre danach wird er mir von seiner Begeisterung für alles, was er damals entdeckte, erzählen“, bezeugt Pierre Daix. „Plötzlich hatte er verstanden, inwiefern Spanien und sogar Barcelona etwas Unzugängliches und Eingeschränktes anhaftete. Er hatte das nicht erwartet.“[20] Seine Seele ist von der Fülle der künstlerischen Eindrücke und von dem neuen Empfinden der Freiheit erschüttert, „weniger von den Sitten… als von der Freiheit der menschlichen Beziehungen“, bemerkt Daix.[21]
„Echte Lehrer“ für Picasso — das sind die älteren Maler des Montmartre, die ihn in die ganze Skala der kulturellen Ereignisse einweihen: Tanzbälle, Konzertcafés mit ihren Stars, die anziehende und unheilbringende Welt der nächtlichen Vergnügungen, die von den Emanationen der weiblichen Reize elektrisiert ist (Forain und Toulouse-Lautrec), aber auch die melancholische Stimmung des grauen Alltags in den Vorstädten, wo die herbstliche Dämmerung das Gefühl der beklemmenden Verlassenheit noch vertieft (Steinlen, mit dem, wie Cirlot mitteilt, Picasso auch persönlich bekannt war).
Aber nicht dem mystischen Ruf Zolas folgend (wie sich Anatole France über Steinlen äußerte), nicht aus Neigung zu einer originellen Lebensweise und auch nicht mit dem Auge eines Satirikers beginnt der junge Picasso seine sogenannte Kabarettperiode. In diesem Thema sieht er die Möglichkeit, das Leben als Drama darzustellen und als dessen Kern den Ruf des Geschlechts. Jedoch erinnern die Unumwundenheit, die Expression und der sparsame Realismus der Auslegung dieser Sujets weniger an die französischen Einflüsse als vielmehr an die Eindrücke, die die späten Werke Goyas auf den jungen Picasso ausgeübt hatten (siehe Bilder wie Der 3. Mai 1808).
Das Gesagte trifft besonders auf das Moskauer Gemälde Rendez-vous (Die Umarmung) zu — absoluter Höhepunkt der Pariser Periode des Jahres 1900 und zweifellos eines der Meisterwerke des frühen Picasso.
Zehn Jahre vor der Schaffung dieses Gemäldes, im Jahre 1890, schrieb Maurice Denis seinen späterhin berühmten Aphorismus: „Daran denken, dass ein Gemälde, bevor es ein Reitpferd, eine entblößte Frau oder irgendeine Anekdote wird, im Grunde eine ebene, mit Farben bedeckte Fläche ist, deren Farben einer bestimmten Anordnung unterliegen.“[22] Vor dem Rendez-vous Picassos dennoch daran zu denken, fällt besonders schwer, da bei diesem Gemälde, ohne jeden ästhetischen Vorbedacht, das Innere über das Äußere triumphiert. Das ist besonders erstaunlich, denn eben weil es „eine ebene, mit Farben bedeckte Fläche mit Farben in einer bestimmten Anordnung“ ist, steht das Gemälde den Arbeiten der Maler der Gruppe „Nabis“ nah (vielleicht weniger dem Werk von Maurice Denis, als vielmehr dem von Edouard Vuillard oder Pierre Bonnard) durch die Gedämpftheit der Farben, die in großen silhouettenartigen Farbflächen aufgetragen sind und eine intime Kammeratmosphäre schaffen. Die äußere Affektlosigkeit aber verbirgt pathetisch leidenschaftliche Emotionen, und das ist natürlich kein „Nabi“ und schon gar kein Toulouse-Lautrec…
Jacob Tugendhold sah in dem hier dargestellten, sich umarmenden Paar „einen Soldaten mit einer Frau“,[23] Phoebe Pool betrachtete es als „Arbeiter und Prostituierte“,[24] Daix liest die Darstellung nach einem anderen narrativen Schema: „Nach der Arbeit findet das Paar wieder zusammen, vereint in unverhohlener Leidenschaft, gesunder Sinnlichkeit und menschlicher Herzlichkeit.“[25] Tatsächlich schildert das Rendez-vous nicht die Sitten der unteren Schichten der Gesellschaft, sondern ein lyrisches und ernstes, beinahe pathetisches Gefühl. Der kühne und begeisterte Pinsel Picassos hinterließ auf der ebenen Fläche ohne Rücksicht auf unwichtige Details gleichsam den Blütenstaub, das Aroma des Lebens, ein von höchstem poetischen Realismus erfülltes Bild.
In demselben Herbst 1900 in Paris schuf der Maler noch drei Fassungen der Umarmung: zwei davon (unverkennbar in der Zeit vorangehend) tragen als Titel Liebespaar auf der Straße und Idyllen des Äußeren Boulevards, die dritte, bekannt unter dem Titel Wollust, ist trotz der Ähnlichkeit in der Komposition und der Staffage eine direkte Antithese zum Moskauer Gemälde, sowohl aufgrund seiner schockierenden Vulgarität, der Anzahl seiner Genreeinzelheiten als auch der sarkastischen Stimmung. Picasso drückt sich als auch in seinen Werken stets sehr direkt aus, und die gewählten Mittel entsprechen immer exakt seiner Absicht.
Als Neunzehnjähriger untersucht er das Thema der Beziehungen der Geschlechter, und seine Gedanken bewegen sich zwischen Kontrasten: Le Moulin de la Galette in der Nacht — das ist der öffentliche Handel mit der Liebe; die Frauen aus den Konzertcafés sind dekorativ wie künstliche Blumen. Die Idyllen des Äußeren Boulevards sind etwas naiv und unbeholfen in ihrer Zärtlichkeit der Umarmung; und in der tristen Mansarde ist die Liebe anders als im Zimmer einer Dienerin der Venus.
Die plötzliche, einer Flucht ähnelnde Abreise des Künstlers aus Paris im Dezember 1900 hatte ebenfalls eine Liebe als Beweggrund — die verhängnisvolle Liebe seines Freundes Casagemas. Den Umständen dieser unglücklichen Liebesgeschichte widmeten die Forscher des Schaffens Picassos erst Aufmerksamkeit, seit sich herausgestellt hatte, dass die dem Andenken Casagemas gewidmeten Bilder im entscheidenden Moment der Herausbildung der Blauen Periode (1901) und während ihres Höhepunktes (1903) gemalt wurden. Casagemas erschoss sich im Februar 1901 in einem Café am Boulevard Clichy; er war nach Paris zurückgekehrt, nachdem Picasso sich vergeblich bemüht hatte, dem Freund unter der Sonne Spaniens das seelische Gleichgewicht zurückzugeben. Picasso war zu dieser Zeit noch in Madrid, wo er die Zeitschrift Arte Joven herauszugeben versuchte (erschienen sind vier Nummern) und Weltszenen und Damenbildnisse malte, in denen er das Unangenehme im Charakter der Modelle unterstrich, bald Raubgier, bald puppenhafte Gemütslosigkeit. Daix sieht hier eine direkte Folge der Tragödie von Casagemas.[26] Diese kurze „weltliche“ Periode — in gewisser Weise der Versuch des jungen Malers, Anerkennung in der Gesellschaft zu finden — endete im Frühjahr 1901, als Picasso nach einem Aufenthalt in Barcelona wieder nach Paris kommt. Dort plant der bekannte Kunsthändler Ambroise Vollard eine Ausstellung der Arbeiten Picassos in seiner Galerie.
In Paris, im Mai und der ersten Junihälfte 1901, arbeitete Picasso mit unwahrscheinlicher Intensität, schuf manchmal während eines Tages zwei, drei Bilder. Er „begann an der Stelle, an der er einige Monate zuvor stehengeblieben war“ (Roland Penrose)[27], aber der Kreis seiner Pariser Sujets ist jetzt breiter, und die Maltechnik ist „avantgardistischer“. Picasso malt nicht nur die Stars der Konzertcafés und die Kokotten der Halbwelt, sondern auch Szenen des Stadtlebens: Blumenverkäuferinnen, promenierende mondäne Paare und das Menschengewühl auf den Rennbahnen, Interieurs der billigen Cafés, schmucke Kinder mit Schiffchen an dem Wasserbecken des Jardin de Luxembourg, Gäste auf dem Dach des Imperial, deren Blicke arrogant über die Seine und die Meere der Pariser Plätze gleiten… Er benutzt die impressionistische Freiheit der raschen Pinselstriche, die japanisierende Schärfe der Kompositionsprinzipien Degas’ und der Plakate Toulouse-Lautrecs, die überhöhte exaltierte Farbigkeit des Kolorits von van Gogh, die den erst im Jahre 1905 deklarierten Fauvismus ankündigte.
Bildnis des Dichters Sabartés (Der Bierkrug), 1901. Öl auf Leinwand, 82 x 66 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.
Aber der sogenannte Präfauvismus Picassos des Frühjahrs 1901 war wiederum nicht so sehr ausgesprochen ästhetischer als subjektiver, psychologischer Natur. Wie Christian Zervos richtig bemerkte, „nahm sich Picasso in acht, um nicht in die Verschrobenheit Vlamincks zu geraten, der Zinnoberrots und Kobalte benutzte, um die École des Beaux-Arts anzuzünden. Picasso machte Gebrauch von den reinen Farben letztlich zur Befriedigung seiner natürlichen Neigung, nur so weit zu gehen, wie es ihm die nervliche Spannung erlaubte…“[28]
Auf der bei Vollard am 24. Mai eröffneten Ausstellung exponierte Picasso mehr als 65 Bilder und Zeichnungen, die zum Teil aus Spanien gebracht wurden, in ihrer großen Mehrheit aber bereits in Paris ausgeführt worden waren. Heftige, oft schockierende Sujets, spontane, energische Arbeit des Pinsels, die Nerven aufpeitschende, wilde (durchaus aber keine freudige, wie es Daix sieht) Farbigkeit charakterisieren diesen sogenannten Stil Vollard. Bald jedoch werden viele der Bilder im präfauvistischen Stil Vollard trotz des finanziellen Erfolgs der Ausstellung übermalt und verschwinden unter neuen Gemälden, die den Wechsel im seelischen Zustand ihres Schöpfers widerspiegeln. „Wer seine Kenntnisse erweitert, erweitert die Trauer.“ Wie eine Antwort auf Ekklesiasts Worte, reift in Picasso nach und nach eine tragische Geistesrichtung, Ergebnis seiner individuellen seelischen Erfahrung, die aber von den psychologischen Gesetzmäßigkeiten seiner Entwicklungsperiode vorausbestimmt wurde. Durch diese seine neue pessimistische Auffassung der Dinge, die sich im Herbst 1901 herausbildete, lässt sich erklären, was Daix den „Bruch mit der Kunst des sinnlichen Anscheins“[29] nannte. Tatsächlich ist jetzt die schöpferische Tendenz Picassos auf die Kunst der von innen her diktierten konzeptionellen verallgemeinerten Bilder gerichtet. Statt auf die aus der Außenwelt geschöpften Sujetfülle konzentriert er sich auf wenige Gestalten, die eher seiner subjektiven geistigen Realität zugehören als der objektiven materiellen. Statt der spontanen und auf fauvistische Art geschärften farbigen Reaktionen drückt sich sein Verhältnis zum Leben jetzt in mehr abstrakten bildlichen Allegorien aus, in denen die farbigen und rhythmischen Strukturen der Komposition symbolisch-poetische Bedeutung gewinnen.
Hier sind zwei sich zeitlich (Herbst 1901) sehr nahe Bilder: Harlekin und seine Gefährtin und die Absinthtrinkerin, die ein beim frühen Picasso häufig anzutreffendes Sujet behandeln: Figuren am Cafétisch. Vom Stil her charakterisiert man sie manchmal als die Bekundung der Vitragenperiode (wegen der den Arbeiten dieser Periode eigenen starken geschmeidigen dunklen Kontur, die große farbige Pläne voneinander abgrenzt). Aber diese der Ästhetik der Art-Nouveau nahe Manier – ihre Entstehung leitet man vom Cloisonnismus Gauguins und von den Arabesken der Plakate von Toulouse-Lautrec ab, den Picasso schätzte — zeugt als poetischer Faktor vom Vorherrschen des intellektuellen Ansatzes in seinem Schaffen, von der Konzentrierung und Abstrahierung seines Denkens. War Picasso früher (von 1899 bis zur ersten Hälfte des Jahres 1901), als er sich mit Cafészenen beschäftigte, die in der Kunst der Jahrhundertwende so oft anzutreffen sind, hingerissen von der „Physiologie“ der modernen Stadt und den bizarren Seiten des Lebens, so kehrt jetzt, in der zweiten Hälfte des Jahres 1901, das Soziale in den Hintergrund zurück, indem es den universell symbolischen Sinn des Bildes unterstreicht.
So erkennt man im Gemälde Harlekin und seine Gefährtin die konkrete Realität jener Epoche: Es handelt sich um ein Café, das eine Art Arbeitsbörse der kleinen Schauspieler war, ein Ort, wo sie sich vorstellten und engagiert wurden. In dem Roman, den die mehrmals von Toulouse-Lautrec verewigte berühmte Sängerin der Konzertcafés Yvette Gilbert über ihr Leben schrieb, gibt es die Beschreibung eines ähnlichen Cafés und seiner Stammgäste, die gut zu dem Gemälde Picassos passt: „Da sind sie, ich sehe sie vor mir, diese lustigen Komiker, exzentrischen Tänzer und Tänzerinnen, Sängerinnen und Sänger, die am Abend den Menschenhaufen mit Chansons, Witzen, Fratzenschneiden belustigen werden und vielleicht Neid über ihre sorglose und frohmütige Existenz hervorrufen; da sind sie, Bleiche, Abgezehrte, mit müden Augen, Hungrige, Frierende und Kranke, mit Spuren von Leid und Sorgen im Gesicht. […] Jeden Tag kommen sie ins ›Café de la Chartreuse‹ in der Hoffnung, ein Engagement zu bekommen, einen Impresario zu finden, der nach einem Conférencier oder einer Sängerin sucht. […] Auch Frauen gibt es hier viele. Arme Mädchen! Blass im grellen Tageslicht, mit einem gespannten und erstarrten Lächeln auf den Lippen, geschminkt mit billigem Puder, mit nachgezogenen Augenbrauen, warten auch sie auf irgendeinen Entrepreneur, dem sie die Reste ihrer verschwindenden Stimme und der vergehenden Jugend feilbieten.“[30]
Aber das Café Picassos hat keinen bestimmten Namen, es ist das Obdach der Obdachlosen. Und der artistisch-nervöse Akrobat Harlekin mit dem weißgeschminkten Gesicht des tragischen Pierrot und seine Gefährtin mit dem Gesicht einer Erscheinung oder einer japanischen No-Maske — das sind keine lebendigen Menschen, sondern die Verkörperung der zweieinigen Seele der Bohème, die durch die banale „commedia della vita“ abgehärtet ist.
Einige der zeitgenössischen Forscher[31] sehen in diesen frühen Gestalten der italienischen Komödie bei Picasso eine Analogie zur symbolischen Poesie des späten Verlains. Etwas weiter gefasst: Man kann feststellen, dass Picasso sich jetzt durch poetische Mittel ausdrückt; das Auge liest das Bild wie ein Gedicht, indem es sich in die Emotionen und die symbolischen Assoziationen der Farbe versenkt, den Sinn der gegenständlichen Verbindungen begreift und sich vom Spiel der sich reimenden Linien bezaubern lässt, die, wie auch die Farben des Gemäldes mit erregender Musikalität ausgestattet und von der Prosaik eines Genrebildes befreit sind.
Kein Zufall aber ist das vor dem Harlekin auf dem Tisch stehende, nicht zu Ende getrunkene große Glas Absinth, bitterer Wermutlikör von grell-grüner Farbe, Allegorie der Bitterkeit des Lebens, die zusätzlich von der Verfluchung des Harlekin-Malers spricht. Das Bild des „verfluchten Poeten“ (hier auch des Malers) war in jener Epoche für Picasso akut. Es floss in eins zusammen mit seinem Ideal der wahren Kunst, mit Paris, mit seiner Gegenwart, seinem eigenen Leben. Der „Fluch“ Baudelaires, Verlains, Rimbauds, Gauguins, van Goghs, Lautrecs war unabdingbar mit dem Bohèmeleben und dem Alkohol verbunden. Bereits in diesem frühen Gemälde hat Picasso die Bedeutung des Alkohols als Mittel zum Unterlaufen der banalen alltäglichen Wirklichkeit durch eine andere, innere, spirituelle Wirklichkeit erkannt, ebenso wie eine Gleichstellung der Kunst und Poesie der „verfluchten“ Artisten mit dem verbrennenden Alkohol (Alcools nannte im Jahre 1913 der Picasso geistig nahestehende Apollinaire seinen ersten Gedichtband), als Elixier der Weisheit, aber auch der verhängnisvollen Melancholie…
In diesem Sinne ist die Absinthtrinkerin ein noch reineres Beispiel sowohl für die oben genannten Ideen als auch für die poetische Form, in der „mit wenigen Worten viel gesagt wird“, und wo das Sujet über sich selbst hinaus wächst.
Die Farben sind hier grob und arm wie Lumpen, und doch sind sie nicht prosaisch, und die Einbildung errät in dem trüben Blau, dem heiseren Rot, im Pergamentgelb ihr edles Wesen: Azurblau, Scharlachrot, Gold. Alles Sichtbare in dem Gemälde ist allegorisch und gewinnt für den Betrachter einen symbolischen, universellen Sinn: Der grüne Absinth im Glas ist die Bitterkeit, die Trauer; im Spiegel an der Wand, auf diesem symbolischen Bildschirm der inneren Welt der Frau, werden ihre verschwommenen Gedanken reflektiert; sie selbst, in der vom Absinth hervorgerufenen Bewusstlosigkeit und Depression, in ihrer gleichsam zu einem Knoten gebundenen Pose, die an eine der Chimären von Notre-Dame erinnert, erscheint schon nicht mehr als einsame Säuferin in der Ecke der Pariser Bar, sondern als Verkörperung des Weltübels mit seinem alchimistischen Attribut — dem am Glasboden schimmernden grünen bitteren Elixier.
In formaler Hinsicht setzen Harlekin und seine Gefährtin und die Absinthtrinkerin die Linie Gauguins fort, in emotionaler Hinsicht eher diejenige van Goghs, der das Nachtcafé in Arles malte, das er als einen schrecklichen Ort empfand, „einen Ort, an dem man umkommen, verrückt werden, ein Verbrechen begehen kann“.[32] Verallgemeinernd kann man sagen, dass zu dieser Zeit die Form in der Komposition vorherrscht und die Themen einen sentimentalen Charakter haben, nach Daix zwei der drei Grundlagen jener neuen Kunst, die bei Picasso während der zweiten Hälfte des Jahres 1901 ausreifte.[33] Das dritte Element — die blaue Monochromie — gab dieser neuen Richtung Picassos ihren Namen: die Blaue Periode, die Ende 1901 einsetzte und bis zum Ende des Jahres 1904 fortdauerte.
Obwohl Picasso selbst mehrere Male die innere, subjektive Natur der Blauen Periode unterstrich, versuchte man lange Zeit ihre Entstehung, besonders die der blauen Monochromie, aus den Einflüssen verschiedener Faktoren zu erklären. Als jedoch nach 65 Jahren die im Herbst 1901 ausgeführten Bilder, die dem Tode seines Freundes Casagemas gewidmet waren, wiedergefunden wurden, schien der psychologische Hintergrund des Übergangs zur Blauen Periode entdeckt. „Erfüllt von dem Gedanken, dass Casagemas tot ist, begann ich in Blau zu malen“, sagte Picasso zu Daix.[34] Und dennoch sind die „blauen“ Gedanken des Malers über den Tod des Freundes durch eine Pause von einem halben Jahr getrennt, sind einige Stilzüge und charakteristische Gestalten bereits fast blauer Gemälde des sogenannten Zyklus, der vom Tod Casagemas, in jenen Bildern formuliert, die die Besuche des Künstlers, im Herbst 1901, im Pariser Frauengefängnis Saint-Lazare widerspiegeln. Wenn man also die vorangehenden schöpferischen Tendenzen Picassos berücksichtigt, wird man die unmittelbare biographische Realität des Künstlers lediglich als eine Art Katalysator seines Krisenzustandes einer geistigen Sehnsucht begreifen, in einer der wichtigsten Etappen seiner Individualisierung und nicht als den eigentlichen ursächlichen Beweggrund dieser Krise.
Carl Gustav Jung, der Vater der Tiefenpsychologie, sieht in der Blauen Periode Picassos einen Abstieg in die Hölle[35], womit er eine Metapher für diese besondere Phase des Werdens findet, in der junge Menschen auf der Suche nach der Wahrheit dazu neigen, sich ins Unbewusste zu vertiefen, dabei vor allem die deprimierenden Seiten des Lebens entdecken und so in das tragische Wesen der Dinge eindringen. Das bestätigt auch Jaime Sabartés, Alters- und Gesinnungsgenosse Picassos, indem er jenen Geisteszustand ihrer frühen Jugend erläutert: „Wir durchlebten jenes Alter, in dem man alles aus eigener Erfahrung begreift, jene Periode der Unbestimmtheit, die jeder vom Standpunkt des eigenen Unglücklichseins durchlebt. Indem unser Leben die Periode des Kummers, der Trauer und des Unglücklichseins durchläuft, bildet es zugleich, mit allen seinen Qualen, die Grundlage seiner (Picassos. — A. P.) Kunsttheorie.“[36]
In Wirklichkeit war diese „antitheoretische“ Theorie (wie Sabartés sie nennt) bei Picasso eine angehäufte Summe von Auffassungen, die Sabartés teilte und die er so wiedergab: „Erwarten wir vom Künstler Offenherzigkeit, sehen wir voraus, dass sie nicht ohne Schmerz sein kann. […] Picasso meint, dass Kunst ein Kind des Kummers und der Trauer ist. […] Er meint, dass Kummer zum Nachdenken anregt und dass die Trauer die Grundlage des Lebens ist.“[37]
Frau mit Haarhelm (Frau eines Akrobaten), 1904. Wasserfarbe auf Karton, 42,8 x 31 cm. The Art Institute of Chicago, Chicago.
La Vie (Das Leben), 1903. Öl auf Leinwand, 196,5 x 128,5 cm. The Cleveland Museum of Art, Cleveland.
Es ist aber erstaunlich und einzigartig, dass dieses Weltempfinden, das eigentlich allen Romantikern bekannt war und das unter der Bezeichnung „Welttrauer“ zum Leitmotiv einer ganzen Kulturepoche an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert wurde, von dem Picasso im Alter zwischen 20 und 23 ergriffen wurde, ihn den Ausdruck einer rein poetischen Metapher finden ließ — das Blau.
Das kalte Blau — die Farbe des Grams, der Trauer, des Unglücklichseins, des Seelenschmerzes, ist aber auch die geistigste der Farben, die Farbe des grenzenlosen Raumes, des Nachdenkens und des Traums. Das Blau wurde auch von den Dichtern geliebt.
Rainer Maria Rilke wurde vor den Gemälden Cézannes im Salon d’Automne (1907) nachdenklich und stellte sich vor, wie jemand die Geschichte der blauen Farbe in der Malerei aller Zeiten schreiben würde, bald einer geistigen, bald galanten, bald ohne jegliche allegorische Bedeutung. Picasso selbst aber schrieb in einem seiner Gedichte im Jahr 1930: „Sie ist das Beste, was es in der Welt gibt. Sie ist die Farbe aller Farben… Die blaueste von allen blauen.“
Man darf Rilkes Gedanken zur blauen Farbe getrost auf die Palette und die Poetik Picassos anwenden, denn seine Blaue Periode erscheint während ihrer ganzen dreijährigen Dauer als eine vieldeutige und komplizierte Kunst, nicht nur in Hinsicht auf den Stil, sondern auch auf den Sinn.
Das Bildnis des Dichters Sabartés stammt, nach Sabartés selbst, eben aus diesem Entstehungsmoment der Blauen Periode: Es war in Paris, im Oktober/November 1901 ausgeführt worden. Es zeigt den Barcelonaer Freund Picassos, nach seinem ersten Eintreffen im herbstlichen Paris, dieser riesigen grauen Stadt, in der er sich einsam und verloren fühlte.
So empfand ihn der Maler, als er, verspätet zum vereinbarten Treff kommend, den Freund in einer melancholischen Erwartung in einem Café hinter einem Bierglas vorfindet. „Mit einem Blick erfasste er, bevor ich ihn bemerkte, meine Pose. Dann reichte er mir die Hand, setzte sich, und wir kamen ins Gespräch“, erzählte Sabartés nach mehr als vierzig Jahren in seinem Buch Picasso, Porträts und Erinnerungen.[38] Das Bildnis wurde in Abwesenheit des Modells gemalt, nach dem Gedächtnis, oder präziser, nach einer Art innerem Modell im Bewusstsein des Malers, das den Eindruck des Treffens in sich bewahrt hatte. Dieses Modell, die Figur im Café, ist gleichsam die Exposition einer malerischen Erzählung. Es ist diesmal eine Erzählung von der Einsamkeit des Dichters, eines Träumers mit kurzsichtigen Augen. Seinem melancholischem Temperament und, wie es scheint, seiner Neigung zum nördlichen Symbolismus (der in Barcelona hochgeschätzt war) ist ein großer Bierkrug als Attribut zugeordnett und nicht ein Glas scharfen Branntweins.
Sabartés erschien dieses Porträt wie eine Widerspiegelung in den Wassern eines blauen mystischen Sees, er erkannte darin die ganze Tiefe seiner Einsamkeit. Für Picasso war das nicht einfach nur ein Bildnis des Freundes, sondern zugleich die Darstellung eines Dichters, was in seinen Augen ein Zeichen besonderer Würde war und von ihm selbst mit dem S. I. Stschukin übergebenen Titel Bildnis des Dichters Sabartés unterstrichen wurde. Wahrscheinlich ist es das erste Gemälde Picassos, in dem die blaue Farbe vorherrscht, obwohl ihre volle Monochromie noch nicht ausgeprägt ist. Zudem ist sie noch nicht durch die reale Farbe der Gegenstände und durch Beleuchtungseffekte motiviert. Das Blau ist hier ein Spektrum von Schattierungen vom grüntürkisfarbenen bis zum tiefen Blau. Man kann wohl sagen, dass das Blau das wirkliche Sujet des Bildes ist, der Ausdruck des wahren Zustands des Dichters, dessen Trauer die Gewähr seiner Aufrichtigkeit ist. Das Blau ist gegenstandslos und universell, es verleiht der Figur Sabartés am Cafétisch die Bedeutung eines Symbols der poetischen Melancholie, die über dem öden Welthorizont liegt.
Das Blau ist die malerische Metapher des Kummers und der Trauer. Und nicht zufällig, sondern aus dem Wunsch heraus, noch unmittelbarer auszudrücken, drängt es Picasso im Jahr 1901 zur Skulptur. Das von Daix festgestellte Vorherrschen der Form in der Komposition ist zweifellos ein Zeichen dieses Interesses, und Picasso wendete sich damals wirklich dem Modellieren zu, denn es half ihm bei der Konkretisierung seiner plastischen Ideen, entsprach aber auch seinem Hang zu strenger Selbstbeschränkung, zum Asketismus der Ausdrucksmittel.
Während aus der Malerei Picassos alles verschwindet, außer einer einsamen menschlichen Figur, während das Kolorit eine volle blaue Monochromie erreicht, wird sein inneres Modell, statisch und kompakt in sich geschlossen (z. B. eine Figur im Café), zur plastischen Idee, die Niedergeschlagenheit ausdrückt. Das bereits in Barcelona in den ersten Monaten des Jahres 1902 gemalte Bild Schlafende Trinkerin ist ein bemerkenswertes Moment dieser Entwicklung. Thematisch setzt es die Linie der Pariser Absinthtrinkerinnen fort, seine plastische Idee führt jedoch zum zentralen Werk des Jahres 1902, dem Ermitage-Bild Die Begegnung: eine gebeugte, niedergeschlagene Figur, die sich kummervoll in einen blauen Mantel hüllt, völlig in sich versunken, wie eine geschlossene Muschel.
Die Entstehung dieser plastischen Idee wird auch in den Pariser Arbeiten der zweiten Hälfte des Jahres 1901 deutlich, in denen die Figuren aussehen, als seien sie in die Umrisse eines romanischen Rundbogens gesetzt. Es handelt sich um die Zyklen der weiblichen Gefangenen und madonnenähnlichen Schwangeren (wie sie Daix bezeichnete), in denen sich eigenartig die Eindrücke Picassos von seinen Besuchen im Herbst 1901 im Pariser Frauengefängnis Saint-Lazare widerspiegelten. Die Entwicklung all dieser Elemente, sowohl der plastischen als auch der sinnlichen, bildet gleichsam die Vorgeschichte der Ermitage-Begegnung.
„Das Herz der Weisen lebt im Hause des Grams.“ Es ist, als wären diese Worte Ekklesiasts die eigenen Gedanken des zwanzigjährigen Picasso, der sich fortdauernd mit dem ewig Weiblichen beschäftigt, überall nach Leiden suchend, nach der tristen Natur der Dinge, im Herbst 1901 den Weg ins Gefängnis Saint-Lazare findet, wo Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem käufliche Frauen untergebracht waren.[39] Mitten im lauten Treiben des Paris der „belle époque“ empfand er das Gefängnis Saint-Lazare als eine besondere, in sich abgeschlossene Welt, ein Eindruck der Zeitlosigkeit, der noch durch die Klosterarchitektur dieser Gebäude aus dem 17. Jahrhundert verstärkt wurde.
Der monotone Rhythmus der Gewölbe und Arkaden, der langen widerhallenden Gänge mit den Häftlingen, die sakrale Atmosphäre des ehemaligen Klosters mussten auf den für Eindrücke empfänglichen Picasso seine Wirkung ausüben.
Ob er bereits um diese Zeit wusste von dem Traum van Goghs (den er damals besonders liebte), heilige Frauen nach der Natur zu zeichnen, die wie zeitgenössische Städterinnen aussehen und gleichzeitig den Christinnen der ersten Jahrhunderte gleichen sollten? Wenn nicht, dann ist die Übereinstimmung beider Künstler bemerkenswert, weil der junge Spanier, der im Gefängnis von Saint-Lazare die beklemmende und rührende Beziehung der Frauen zu ihren Kindern beobachtete (denn die Gefangenen durften ihre Säuglinge bei sich haben), das Thema der Prostituiertenmütter zu seinen madonnenartigen Schwangeren von Saint-Lazare entwickelte. Von der Grundidee sind diese Schwangeren hypothetisch auch mit dem Goetheschen Mythos von den Müttern, den großen Göttinnen, den Hüterinnen des Ursprungs alles Zukünftigen verwandt (siehe Faust, Teil II, Szene „Dunkle Galerie“). Das klingt weniger merkwürdig, wenn man den Einfluss der Ideen Goethes auf den Symbolismus allgemein berücksichtigt, und in der großen, synchron mit den Schwangeren von Saint-Lazare gemalten Programmkomposition Das Begräbnis von Casagemas viele bildliche Anspielungen auf zwei Schlussszenen aus Faust (Teil II, „Grablegung“ und „Bergklüfte, Wald, Felsen, Wüste“) findet. Jedenfalls ist sicher, dass der vom blauen Weltempfinden erfasste Picasso im Konkreten das Universale, das Symbolische zu begreifen beginnt, das Suggestive des Gedankens, das Bohrende der Emotion, den Ausdruck von Weltschmerz.
Dieses Erlebnis war weniger empirisch als existentiell. In den Darstellungen der Frauen, die er beobachtete oder sich vorstellte, gibt Picasso keine individuellen Züge oder sozialen Typen wieder, vielmehr drückt er allein die Kehrseite des ewig Weiblichen aus: das metaphysische, leidende Wesen der Frau.
Sogar solche Realitäten wie der Krankenhauskittel und die charakteristische weiße Haube der Gefangenen verwandeln sich bei ihm in abstrakte Mäntel und eine Erinnerung an die phrygische Mütze Mariannes; durch das schöpferische Empfinden umgestaltet, werden sie in der Kunst Picassos zu verschwommenen Spuren der Kleidungsstücke von Saint-Lazare. Und indem man ihre aufdringliche Anwesenheit betrachtet, wird einem bewusst, wie stark die Begegnung mit der düsteren Wirklichkeit des Gefängnisses die Gestaltung der Bildhaftigkeit und Stilistik der Blauen Periode zumindest im Lauf des ganzen Jahres 1902 beeinflusste.[40] Ein halbes Jahr später, nach der Rückkehr aus Paris nach Barcelona, arbeitet Picasso an dem Bild, von dem er an Max Jacob schrieb, dass es ein Straßenmädchen aus Saint-Lazare und eine Mutter darstellt. Dieses Bild ist Die Begegnung.
Doch in dem erwähnten Brief nennt es Picasso Zwei Schwestern (so ist auch die Zeichnung benannt, die wahrscheinlich dem Brief als Illustration beigelegt wurde), worin sich die eigentliche Idee des Autors ausdrückt. Die Benennung Zwei Schwestern muss man natürlich allegorisch, symbolisch verstehen, als zwei metaphysische Aspekte des gleichen einheitlichen Frauenwesens – des erniedrigten und des gehobenen, zwei Wege des weiblichen Schicksals — „ein Straßenmädchen aus Saint-Lazare“ und „eine Mutter“. Nach den Skizzen zu urteilen, herrschten auf dem Bild anfänglich volkstümlich-sentimentale Töne vor, eine Art Erzählung von einem Straßenmädchen, dem in Gestalt einer Schwangeren mit einem Säugling auf den Armen die heilige Mutterschaft erscheint.
Nach und nach jedoch befreit sich das Sujet von nebensächlichen Einzelheiten, wie Mimik und Geste, von den Details der körperlichen Gestalt, der Kleidung. Alles im Bild, was die äußeren Aspekte des Geschehens betrifft, ist allgemein und karg bezeichnet: Der Ort — eine Wand mit einem bogenartigen Durchbruch; die Posen und Gesten der Dargestellten sind steif und passiv; ihre Gesichter sind unpersönlich, die Kleidung ist gewöhnlich. Picasso reduziert nicht nur die dargestellten Details, er schränkt sich absichtlich in den Mitteln seiner malerischen Darstellung ein und geht in dieser Selbstbeschränkung bis zur Askese. Der Realitätsferne und Einfachheit der blauen Monochromie entspricht die Ursprünglichkeit der kompositorischen Lösung, die Abstraktion der Plastik und der Linienumrisse.
Alter Jude mit einem Knaben, 1903. Öl auf Leinwand, 125 x 92 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.
Das Picknick der Familie Soler, 1903. Öl auf Leinwand, 150 x 200 cm. Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, Lÿttich.
Kopf einer Frau mit Halstuch, 1903. Öl auf Leinwand, auf Karton geklebt, 50 x 36,5 cm. Ermitage, St. Petersburg.
Indem er die malerische Sprache vereinfacht, kompliziert und vertieft Picasso den Inhalt des Gemäldes; das ursprüngliche Sujet ist zu einem universell zeitlosen Ereignis entwickelt — der tragischen Jenseitsbegegnung zweier symbolischer Schwestern. Ihre Gegenüberstellung (der Erhobenen, Ewigen mit der Erniedrigten und der Verdorbenen) ist in der formalen Lösung der Gestaltung ausgedrückt, den intensiven und himmelblauen Farbtönen der Mutterfigur entspricht ihre frei fließende Zeichnung; die Prostituierte dagegen ist in leblosen grünlich grauen Schattierungen, dem Farbton des feuchten Lehms dargestellt, mit knapp modellierten Formen, eckigen Rhythmen in ihrer Pose und mit starken Schatten in den Falten der Kleidung. Der überweltliche Sinn und der Gram der Mutterschaft ist durch die weit aufgerissenen, allwissenden Augen der Mutter ausgedrückt, wogegen all das, was der dem Tod verwandte Schlaf an Tiefe, existentieller Angst und Metaphysischem birgt, in der Schwere der geschlossenen Lider, in den totenähnlichen Schatten auf dem wächsernen Gesicht der Prostituierten am düsteren Torbogen ausgedrückt ist.
Es scheint, dass S. I. Stschukin gerade Die Begegnung meinte, als er sagte, Picasso hätte Kathedralen ausmalen sollen. Denn sogar die formalen Komponenten des Bildes reichen gleichsam in die Traditionen der sakralen Kunst zurück: die Komposition bis zu den antiken Grabmälern und dem mittelalterlichen ikonographischen Schema der Begegnung Marias mit Elisabeth; die dargestellten Personen erinnern an die von epischer Würde erfüllten Figuren Giottos oder Masaccios oder an die spirituellen Gestalten gotischer Statuen; das monochrome Kolorit an die übersinnliche blau-grüne Tonalität von Luis de Morales.
Die Skizzen zeigen jedoch, dass Picasso nicht von den ikonographischen oder stilistischen Klischees der alten Kunst angeregt wurde. Vielmehr interpretierte er das Thema der Begegnung zweier Frauen bloß durch eine plastische Idee, die den Archetyp Begegnung ausdrückt. Was in den Skizzen mittels Verbindung der Hände der zwei Schwestern dargestellt wurde, wird in dem Gemälde in die ganze Komposition übertragen: Die zueinander geneigten Figuren ähneln einem Bogen, der mit der dunklen Bogenöffnung im Hintergrund links korrespondiert. Damit erreicht Picasso eine tektonische Einheit der zweifachen Komposition und verleiht seiner plastischen Idee gleichzeitig eine suggestive Wirkung der poetischen Metapher „Begegnungsbogen“ (Wohltätige Besuche bei den Eingekerkerten waren eine der bemerkenswerten Besonderheiten im Gefängnis Saint-Lazare, die Picasso beobachten konnte).
Vielleicht entdeckte Picasso gerade in dem Gemälde Die Begegnung für sich zum ersten Mal jenes Gesetz der assoziativ-plastischen Gleichstellung verschiedener Objekte, das künftig ein aktives und wichtiges Instrument seiner bildlichen Poetik wird. Diese Poetik der Metamorphosen, die von ihm in der Epoche des Kubismus entwickelt wurde und die er bis zum Ende beibehielt.
Die Begegnung, die wahrscheinlich im Herbst 1902 vollendet wurde, ist der Höhepunkt der Anfangsphase der Blauen Periode, die unter dem Zeichen der Entwicklung der Themen von Saint-Lazare verlief. Im Lauf des Jahres 1902, das Picasso zu drei Vierteln in Barcelona verbrachte, entfernt sich seine Kunst weit von der realen Wirklichkeit in das Gebiet der transzendenten Ideen, in denen er nur seine subjektive seelische Erfahrung ausdrückt. Seine Gestalten sind bedingt, anonym, zeitlos, als seien sie Gestalten seiner Ideen. Visuelle Bestimmtheit verleiht ihnen die plastische Modellierung der homogenen Form, das Gefühl für Maß und Breite der linearen Rhythmen, die eher einem Bildhauer eigen sind (wie bei der Skulptur eines assyrischen Reliefs), und nicht die sich auf das Gefühl der Realität stützende Eingebung eines Malers, der die Möglichkeiten der Pinsel und Farben ausschöpft. Um diese Zeit will Picasso, nach Daix’ Aussage, das Übereinstimmen der Form mit der Idee erreichen. Sein Suchen findet jedoch kein Verständnis bei seiner nächsten Umgebung in Barcelona, was er in dem bereits erwähnten Brief im Zusammenhang mit der Geschichte des Bildes Die Begegnung an Max Jacob nach Paris beklagt, und ironisch bemerkt er, dass seine Freunde — hiesige Maler — in seinen Werken zu viel Seele bei Abwesenheit der Form finden.
Dass Picasso um Verständnis bei seinem ersten Pariser Dichterfreund sucht (die Bekanntschaft begann während der Ausstellung bei Vollard im Jahr 1901 und ging sofort in eine Freundschaft über), erklärt seine erneute Reise nach Paris im Oktober 1902, wo er zusammen mit Max Jacob lebte, mit ihm Not und Elend teilte und aufgrund der ungewöhnlichen Winterkälte nur drei Monate, bis Mitte Januar 1903, durchhielt. „Schreckliche Zeit der Kälte, des Elends und des Abscheus – besonders des Abscheus”, sagt er. Gerade daran erinnerte er sich mit besonderem Widerwillen, jedoch nicht des materiellen Elends und der Entbehrungen wegen, sondern der moralischen Not, die ihn manche seiner katalonischen Freunde, die damals in Paris in besserer Lage waren, fühlen ließen.[41]
Paris brachte aber auch, wie schon während der vorangegangenen Besuche, Neues in seine Kunst ein. Im Gegensatz zu den kläglichen Lebensverhältnissen des Winters 1902/1903 bewegt sich die Phantasie Picassos, des Malers, in der Welt der „reinen und einfachen Menschheit“ (Daix): Hirten und Fischer, deren Leben hart und dürftig ist, aber durchdrungen von der Moral eines heroischen Stoizismus. In dieser legendären, von epischer Erhabenheit erfüllten Welt philosophischer Anspruchslosigkeit und ruhiger Weisheit, der einfachen und starken Gefühle, der allgemeinen Vergeistigung der Natur, lässt sich der Nachhall der antiken Mythen spüren, der ethischen Ideale Puvis de Chavannes, Gauguins, Alfred de Vignys, aber auch der Nachhall eigener Erlebnisse während der Monate in Horta de Ebro vor vier Jahren[42]. In Paris, wo er nicht die Mittel besaß, um in Öl zu malen, fertigte Picasso Zeichnungen an.
Als er sich in Barcelona wieder an die Ölmalerei macht, kommt ihm seine neue graphische Erfahrung zugute. Er verwendet größere Aufmerksamkeit auf die Probleme des Raumes, der menschlichen Anatomie, der Konkretheit der Objekte, deren Kreis sich im Vergleich zum Jahr 1902 wesentlich erweitert. In den bedeutendsten Gemälden der ersten Hälfte des Jahres 1903 — Arme Leute am Meeresstrand oder die Tragödie (Z. 1. 208), Rendez-vous und Das Leben — werden für die Blaue Periode universale Motive der Welttrauer und des ewig Weiblichen zu Szenen von Wechselbeziehungen zwischen individualisierten Personen — Männern, Frauen, Kindern. So drückt Picasso seine seelischen Erfahrungen in diesen Bildern gleichsam als symbolisch-mythologische blaue Träume aus, die die modernen Forscher zu psychoanalytischen Deutungen veranlassen.[43]
Unterdessen beginnt die Schärfe der seelischen Krise sich abzustumpfen, das Bewusstsein sucht sich einen Ausgang nach außen, in die reale Wirklichkeit, und als Folge zeigt nun Picassos Malerei einen Drang zur Konkretheit, mit Interesse an der Stadtlandschaft, wiewohl auch verwischt durch die Dunkelheit der Nacht, und vor allem am Porträtgenre, was sich gegen Mitte des Jahres 1903 offenbart. Damals wurde das Porträt von Soler gemalt, dem das Bildnis seiner Frau und das Gruppenbild der ganzen Familie Soler bei einem Sommerpicknick folgte.
Alle drei Gemälde lassen sich nach Größe und Komposition relativ leicht zu einem Triptychon anordnen, obwohl das Ermitage-Bildnis sich durch einen unmittelbareren, intim freundlicheren Charakter von dem Bildnis der Frau Soler und dem Picknick der Familie Soler unterscheidet, deren Stil fein auf die repräsentative Erstarrtheit der Fotoporträts jener Zeit anspielt.
Benito Soler Vidal war ein Modeschneider in Barcelona, Freund und Mäzen der Künstler, die im Kabarett „Els Quatre Gats“ zusammenkamen, und wahrscheinlich derjenige, der in dieser Gesellschaft den Typ des vollkommenen Dandy repräsentierte. Als solch einen melancholischen Dandy hat Picasso ihn auch dargestellt, indem er die ganze mystische Tiefe des unergründlichen Blaus ausnutzte, um den Porträtierten aus seinen Alltagsverhältnissen in jene anderen zu übertragen, die viel besser zu seinem edlen Äußeren passen. Er umgab Soler mit einer kosmischen Nacht, indem er sein schmales Gesicht jenem blassen Himmelskörper ähnlich machte, der kaum von lebendigen Farben berührt ist. Der artistische Wille Picassos hat hier augenscheinlich die Oberhand über die wirkliche Psychologie des Modells gewonnen. Das Porträt von Soler ist aber auch dadurch gekennzeichnet, dass es das Bestreben des Malers deutlich macht, einen körperlichen Typ zu finden, der geistige Sensibilität ausdrückt. Und hier leitet das Ermitage-Porträt zu den zweifellosen Meisterwerken des Herbstes 1903 über, wovon eines der Alte Jude mit einem Knaben ist.
Das Thema des menschlichen Elends, das in der Abbildung von Armut und körperlicher Behinderung, von Alter, Blindheit, Hunger und Obdachlosigkeit dramatisiert ist, wird durch den Kontakt mit der Realität noch weiter konkretisiert. Von vielen Autoren wurde bemerkt, dass der Anblick von bettelarmen Vagabunden und Krüppeln keine Seltenheit für die Barcelonaer Straßen zu Anfang des Jahrhunderts war und dass von einem Kollegen Picassos, dem Maler Nonell, bereits ähnliche Sujets mit dem düsteren Kolorit des „schwarzen Spanien“ benutzt worden waren. Doch Picasso greift „wieder eine Note höher, als es in der Partitur steht“: Die körperlichen Schwächen interessieren ihn nur als Metapher der Geistigkeit, die durch das Leid verschärft ist. Während das von Picasso während des Pariser Winters 1902/1903 aus seiner Phantasie geborene „Sisyphusgeschlecht“ von untersetzten, dorischen Proportionen war, so führt ihn im Barcelona des Herbstes 1903 der Trend zu reinen und gedehnten Linien (indem sich Picasso ihrem musikalischen Spiel hingibt, bedeckt er planlos Blatt um Blatt mit Skizzen von nackten Körpern, Gesten, Posen, Profilen), manieristisch langgezogenen Figuren, die die Forscher an El Greco, Morales, an den Graphismus romanischer Fresken und der Reliefs Kataloniens erinnern.
Zwei Figurenstudien und Kopf eines Mannes im Profil, 1901. Tempera, Öl auf Karton, 41,2 x 57,2 cm. Ermitage, St. Petersburg.
Greisenkopf mit Krone (Der König), 1905. Aquarell, Tusche, Feder auf Papier, 17 x 10 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.
Mädchen auf der Kugel, 1905. Öl auf Leinwand, 147 x 95 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.
Andere Wissenschaftler verbinden die neuen Stimmungen des Malers mit den unter den Symbolisten Barcelonas populären philosophischen Ideen Nietzsches über die „Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik“.[44] Wie dem auch sei, die geheime Logik des schöpferischen Instinkts Picassos kristallisiert aus den linearen Melodien seiner Skizzen jener eckigen Abrisse asketischer Figuren, nackter Frauenkörper, spanischer Gitarren, reiner Ovale junger Gesichter, scharfer Profile mit singenden Mündern und leeren Augenhöhlen der Blinden, nervöser, zartfühlender Hände heraus, die in die Gemälde Abendmahl des Blinden, Der Blinde (Z. 1. 172), Alter Jude mit einem Knaben, Alter Gitarrenspieler, Der Geistesgestörte eingehen werden.
Das sind die blauesten Gemälde der Blauen Periode, und Alter Jude mit einem Knaben ist der Farbe nach nahezu das monochromste und homogenste Gemälde von allen. Aber was bedeutet jetzt dieses Blau — ausgebleicht, gespenstisch, grau, kalt wie nie, der einzige Farbton, mit dem die ausgedorrte Figur des blinden Alten und sein halbwüchsiger Führer wiedergegeben sind? Wer sind sie, diese Gestalten, deren katalonische Urbilder in Zeichnungen auftauchen, die Erinnerungen Picassos an Horta de Ebro sind? Worin liegt der Sinn der sensiblen Blindheit des einen und des mit abwesendem Blick schauenden, passiven Sehens des anderen? Welches Gleichnis könnte Auskunft geben, warum sie aneinander geschmiegt dasitzen am Rande der Welt, der Zeit, des Lebens oder eines Traums?…
Es gibt Gestalten, die allgemeinbedeutende Lebenszustände der Menschheit ausdrücken, Beziehungen zwischen den Menschen und ihre Konflikte, und die in der kulturellen Geschichte in Form von „Wandersujets“ immer wieder erscheinen. Ein blinder, durch Leid weise gewordener Alter, ein Bettler, der alles auf Erden verloren hat, ein Wanderer, der vom ewigen Fluch getrieben wird, das waren einmal Ödipus, Hiob, Ahasver. Aber vielleicht sind sie nur Inkarnationen des einen Archetyps, der die Zunahme des Geistigen bei Abnahme der Körperlichkeit ausdrückt. Im 19. Jahrhundert findet die reine Menschlichkeit (die höchste Geistigkeit in der Auffassung jener Zeit) in den Romanen von Dickens und Dostojewski einen durchgehenden Ausdruck in der Figur eines bettelnden Alten mit einem Waisenmädchen, ein unendlich rührendes und gleichzeitig von der Erhabenheit des Symbols zeugendes Bild.
In dem Alten Juden mit einem Knaben behandelt der Maler den humanistischen Mythos des 19. Jahrhunderts, aber mit einer biblischen Hoffnungslosigkeit hinsichtlich des menschlichen Schicksals. Dieses Gemälde zeigt uns, wie sich die Lösung der ethischen Krise der „blauen Jahre“ Picassos andeutet. Denn es ist das Streben zur höchsten Ausdrucksfülle, das hier die spürbar sensible Plastik diktiert, die Schärfe der perspektivischen Verkürzung, komplizierte lineare Rhythmen, mimische Kontraste der dargestellten Personen und schließlich das höchst intensive aschfarbene Blau, diese bis zum Manierismus reichende Exaltation der Form, die sich jetzt auf die durchbohrende Kraft seines Verhaltens stützt. Das auch im Alten Juden mit einem Knaben vorhandene Motiv der Blindheit war für Picasso von besonderer Bedeutung, was von Penrose exakt analysiert wurde.
„Im Akt der Empfindung wird Picasso immer überrascht durch die Divergenz zwischen der Vision des Gegenstandes und der Kenntnis über ihn. Das Äußere ist für Picasso auf absurde Weise inadäquat. Das Sehen ist ungenügend, ebenso wie die Informationen der anderen Sinnesorgane. Andere Geistessphären müssen sich einschalten, damit die Empfindung zum Verständnis führt. Irgendwo im Treffpunkt der sinnlichen Empfindung mit den tiefen Bereichen des Geistes gibt es ein metaphorisches inneres Auge, das emotional sieht und empfindet. Durch dieses Auge der Phantasie kann man sehen, verstehen und lieben ohne Sehen im physischen Sinne, und dieses innere Sehen kann weitaus intensiver sein, wenn die Fenster zur Außenwelt verschlossen sind.“ Ferner führt Penrose die von Picasso ihm gegenüber bereits in den dreißiger Jahren geäußerte rätselhafte Sentenz an: „In der Tat hat nur die Liebe Bedeutung, gleichviel was für eine. Und den Malern hätte man die Augen ausstechen müssen, wie man das mit Stieglitzen tut, damit sie besser singen.“[45] Indem das Picasso sagte, dachte er vielleicht an seinen blinden Minotaurus, der von einem kleinen hilflosen Mädchen geführt wird, von diesem späten Widerhall des blinden Alten mit dem Waisenkind des Jahres 1903, die miteinander durch die Geistigkeit der Liebe vereint sind.
1904 erreichte die Blaue Periode mit ihrer pessimistischen Verschlossenheit und der gespannten Suche nach dem ethischen Absoluten ihre letzte Phase. Die Krise der Jugend wurde von einem neuen Stadium des Individualisierungsprozesses abgelöst, vom Stadium der Selbstdisziplinierung. Stärker als bisher bestimmt Picasso jetzt die äußeren Verhältnisse selbst, plant im Voraus noch eine Reise nach Paris, um andere Luft zu atmen, eine andere Sprache zu reden, die ihn umgebenden Gesichter und seine Lebensweise zu wechseln.
Im April 1904 kommt er nach Paris, und zwar, wie sich herausstellen wird, für immer. Er lässt sich in den Werkstätten „Bateau-Lavoir“ (eine schwimmende Wäscherei) nieder, wie Max Jacob diese hölzerne, seltsam konstruierte Baracke später taufte, die auf den Höhen des noch fast ländlich stillen Montmartre klebte. Für die nächsten fünf Jahre wird das „Bateau-Lavoir“ zum Haus Picassos, und die Atmosphäre dieser Bohèmewelt, die den Stempel der Armut trägt, wird zur Atmosphäre seiner Gemälde der Jahre 1904-1908. Bald mündet das Leben Picassos im Hafen der Ehe, er verbindet sich mit der schönen Fernande Olivier.[46] Neue Bekanntschaften und Freundschaften werden geknüpft. Ein eigenes Haus, eine eigene Familie, eigene Wahl der Verbindungen — die Einstellung zum Leben wird solider und positiver. Mehr noch als der Umgang mit den Berufskollegen bedeutet für Picasso jetzt der Umgang mit Menschen anderer künstlerischer Berufe, besonders mit den Dichtern, unter denen nun auch André Salmon und Guillaume Apollinaire erscheinen.
Zu den allerersten Pariser Freunden Picassos gehörten die später bekannte Sängerin Suzanne Bloch und ihr Bruder, der Violinist Henri Bloch. Im Jahre 1904 schenkte er den beiden sein Photo, malt ein großartiges Porträt von Suzanna und überlässt Henri Bloch das kleine Gemälde Kopf einer Frau mit Halstuch. Dieses Werk, das gewöhnlich mit Picassos Aufenthalt in Barcelona im Jahre 1903 datiert wird, ist jedoch weitaus kennzeichnender für die ersten Pariser Monate des Jahres 1904, in denen er viel aquarellierte und sich mit Graphik beschäftigte. Das Blau ist jetzt verdünnter, fast durchsichtig und leicht mit Rot eingefärbt, die Zeichnung ist akzentuierter und verbindet feines Gefühl für die Details mit einer expressiven Stilisierung. Gleichzeitig (und das ist bemerkenswert für das Ende der Blauen Periode) ist jetzt die individuelle Psychologie der Gestalt ausschlaggebend für die Stimmung. Diese Frau mit dem kurzgeschorenen Haar (wie bei den Insassen von Saint-Lazare) ist wahrscheinlich keine konkrete Person, sondern Produkt der Vorstellung Picassos, die Vorbotin der hungernden Freundin des bettelnden Blinden aus der Radierung des Jahres 1904 Das kärgliche Mahl.
Zusammen mit der naturalistischen Tendenz der Graphik im Jahre 1905 wächst in der Kunst Picassos das erzählerische Element. Auf eine überraschende Wechselwirkung dieser Art wies, ebenfalls 1905, der russische Dichter Alexander Block hin: „Oft fallen die Grundlagen des Satzes — Substantiv und Verb — zusammen, das erste mit der Farbe, das zweite mit der Linie.“[47] Jetzt ist Picassos Linie beweglich, sensibel in den Details und gleichzeitig leicht, verfeinert und nervös, als singe sie auf einer höheren Note der Form. Lange, biegsame Körper in voller Größe, erhobene spitze Ellenbogen, geschmeidige Extremitäten, feines Profil, verschiedene Rundungen, Winkel, Falten, das ist eine Linie des lyrischen Timbre, und sie erfordert eine entsprechende Art von Sujets, die den Prosagedichten ähnlich sind, indem sie einerseits einen intimen Charakter, andererseits aber einen philosophischen Hintergrund aufweisen.
Diese Sujets entstammen der Welt des Zirkus, die reich an Elementen ist, die eine lyrische oder philosophische Interpretation zulassen. Das gilt besonders für Picasso, nach seiner Auffassung war die Welt des Wanderzirkus eine Metapher seines eigenen Milieus, der artistischen Bohème vom Montmartre, die „schlecht, aber herrlich lebte“ (Max Jacob), in einer fieberhaften Erregung des Geistes und einer hungrigen Zugespitztheit der Empfindungen, in der Heiterkeit allgemeiner Verbrüderung und der beklemmenden Melancholie der Einsamkeit. Picassos Sehen ist das vergeistigte, bildhafte Sehen eines Dichters, das seinem inhaltlichen und emotionalen Spektrum nach jener Atmosphäre nahe ist, von der die kleinen Poeme Baudelaires, einer der geistigen Lehrer Picassos und seiner Dichterfreunde, durchdrungen sind. In seiner sozialen Außenseitersituation sahen diese jungen Leute ein Zeichen der Verwandtschaft mit dem Schicksal des „verfluchten Dichters“ und der Blick in die Geschichte richtet sich unausweichlich auf die Figur Baudelaires — die heroische Persönlichkeit des rebellischen Genies, das für sie einer jener Leuchttürme war, von denen er selbst einmal schrieb. Mehr noch, in gewissem Sinne erinnert auch der Montmartre dieser jungen Dichter und Maler — der Dachboden und die Mansarde von Paris — an jenes dürftige und gleichzeitig zauberhafte, in rosa und blau getauchte zwiespältige Zimmer, das Baudelaire in einem seiner Prosagedichte beschrieb.
Als direkter Widerhall auf ein anderes Gedicht Baudelaires, Les Bons Chiens, erscheint der Knabe mit Hund. „Ich besinge den schmutzigen Hund, den armen Hund, den obdachlosen Hund, den Hund als Vagabunden, den Hund als Komödianten, den Hund, dessen Instinkt dem Instinkt eines Habenichts, eines Zigeuners und eines Straßenakrobaten ähnlich ist, so erstaunlich von der Not verschärft, von dieser guten Mutter, der wahren Gönnerin der Vernunft!“ Picasso hat hier wie kaum jemand Baudelaire verstanden in seinem Bestreben, die „braven Hunde zu besingen, die unglücklichen, schmutzigen Hunde, die jeder davonjagt wie Krankheiten, außer vielleicht der Arme, dem sie Gefährten sind, und der Dichter, der sie mit dem Blick eines Bruders ansieht“. Dieselben von der Not geschärften Instinkte, der richtige Spürsinn für die Werte des Lebens und das philosophische Begreifen des Lebens sind auch den Gefährten des Hundes in einer Gouache Picassos eigen — dem in Lumpen gekleideten, aber von spröder und eckiger Grazie in der Art des Quattrocento erfüllten Knaben. Mit der Gelassenheit des Tieres unter der Hand des Knaben, der gleichen Wendung ihrer Köpfe, der Übereinstimmung der Rhythmen zeigt der Maler die Verbindung zwischen dem einsamen Halbwüchsigen und dem Hund, als würden dessen kluge Augen, wie in Baudelaires Gedicht, sagen: „Nimm mich mit, vielleicht schaffen wir uns aus unserer Not eine Art Glück.“
Diese Stimmung sentimentaler Melancholie ist das Leitmotiv der Werke Picassos der sogenannten Zirkus- oder Rosa Periode des Jahresendes 1904 und der ersten Hälfte des Jahres 1905. Alle Werke dieser Zeit, darunter auch die Gouache Knabe mit Hund, befinden sich in naher oder ferner Beziehung zu der bereits Ende 1904 beabsichtigten gewaltigen Komposition aus dem Leben des Wanderzirkus.
Clown und junger Akrobat, 1905. Kreide, Pastell und Aquarell auf Papier, 60 x 47 cm. The Baltimore Museum of Art, Cone Collection, Baltimore.
Akrobatenfamilie mit Affen, 1905. Gouache, Aquarell, Pastell und Feder auf Karton, 104 x 75 cm. Göteborg Konstmuseum, Göteborg.
Die Spanierin von Mallorca, 1905. Gouache, Aquarell auf Karton, 67 x 51 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.
Szene im Interieur: Liegende nackte Frau mit Katze und nackter Knabe, 1905. Gouache, Kohle auf Karton, 52 x 67,5 cm. Ermitage, St. Petersburg.
Die Summe der Arbeit an dieser Komposition mit allen Präzisierungen und Änderungen des Planes, den Studien und Ausführungen einiger Motive in einzelnen Gemälden ergibt schließlich jene Zirkusperiode, die gelegentlich auch die Saltimbanque-Periode genannt wird. Ein Hauptgemälde dieser Periode, das gegen Ende 1905 gemalt wurde, ist die Gauklerfamilie. Die vor kurzem durchgeführten Untersuchungen des Bildes offenbarten die Mehrstufigkeit und Kompliziertheit der Entwicklung seines Planes und seiner Komposition: Picasso hatte nicht weniger als zwei selbständige Gemälde auf derselben Leinwand gemalt, die in vier aufeinander folgenden Phasen fixiert wurden, bevor er das Endergebnis erreichte.[48]
In dem ersten dieser gemalten Bilder, Rast der Gaukler — es ist bekannt als Aquarell mit dem gleichen Titel und als Trockennadelradierung — gab es das Motiv eines auf der Kugel balancierenden jungen Akrobaten mit einem diese Übung beobachtenden älteren Kollegen in der Kleidung eines Harlekins. Dieses zentrale Motiv der ursprünglichen Komposition wurde bewahrt und in das bekannte Bild Mädchen auf der Kugel umgearbeitet.
Wenige Monate trennen das Mädchen auf der Kugel von seiner Quelle Rast der Gaukler, einer eigenartigen Antwort Picassos auf Gauguins Frage: „Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir?“ Voll intimer Genrepoesie in den Details, ist diese Komposition ähnlich einem Fries aufgebaut, sie erreicht jedoch nicht jene Monumentalität, die einem Gemälde solcher Größe ziemt, und wurde von ihrem Schöpfer verworfen.
Im Mädchen auf der Kugel entwickelt Picasso die Komposition in die Tiefe, indem er nach Gesammeltheit strebt: Die Hauptgestalten und Figuren der Staffage erobern fortlaufend die sich entfernenden räumlichen Pläne der nackten Landschaft. Zum ersten Mal in seinem Schaffen entsteht ein Bild des Raumes (nicht mehr des mystischen blauen Nichts oder Irgendwo, sondern eines gegenständlichen, sachlichen) und damit als Folge das Problem der räumlichen Form (nicht der symbolischen, expressiven, sondern der plastischen). Einmal entstanden, beherrscht das Problem der Form die Aufmerksamkeit des Malers so stark, dass es das Interesse am eigentlichen Sujet verdrängt. Im Mädchen auf der Kugel wird eine alltägliche Szene aus dem Leben der wandernden Zirkusartisten dargestellt, die Probe einer akrobatischen Nummer, zur Arena, auf der sich ein erregendes Spiel der Formen vollzieht.
Der Ausgangsplan Picassos ist noch ganz literarisch: Die sich mit Kindern und Hund in dem leeren Raum der Landschaft entfernende Mutter und das in der Ferne wandernde gespenstische weiße Pferd drücken den philosophischen Raum jener Frage Gauguins aus: „Woher?… Wer?… Wohin?…“ Aber die Szene im Vordergrund wächst ihrer Bedeutung nach in die Antwort hinüber: „Aus dem Grenzenlosen… Artisten… In die Ewigkeit“, denn in der Charakterisierung des Zirkusathleten und der Akrobatin betont Picasso ihren Kontrast. Der Kontrast dieser Menschenwesen: des mächtigen Athleten, der fest und gerade auf einer kubischen Unterlage sitzt, und des graziösen, biegsamen Körpers der Akrobatin, die das Gleichgewicht auf der großen Kugel hält, wird jedoch nach und nach zur Antithese der formalen Wesenheiten: der Standfestigkeit und des Heruntergleitens, der Schwere und der Leichtigkeit. Um der Verstärkung dieses Kontrasts willen verändert der Maler die natürlichen Proportionen und die perspektivischen Verkürzungen, übertreibt er die Mächtigkeit des Athleten, verwandelt ihn in einen Koloss, in einen unerschütterlichen Monolith, der gut die Hälfte der Bildebene einnimmt. Auf der anderen Seite findet die junge Akrobatin ihren Platz, umrahmt von der öden Landschaft. In labiler Balance schwankend, erscheint sie ganz und gar wie die elegante s-förmige Linie eines Stammes, der sich in den mageren Händen verzweigt, die mit der Musik ihrer Gesten zum Himmel gerichtet sind. In dem Poem Apollinaires Wolkengespenst gibt es ein ähnliches Bild eines kleinen Straßenakrobaten: „Und als er auf die Kugel kletterte, wurde sein schlanker Körper zarte Musik, und es gab in der Menge keinen Gleichgültigen mehr. Ein kleiner Geist ohne eine Spur von Fleisch, so dachte jeder.“
Der Kontrast der Gestalten lässt sich leicht in einen mehr abstrakten Plan überführen: von der Indolenz gehemmte Materie und der strömende ätherische Geist. Nicht umsonst ist der in die ganze Breite entfaltete Rücken des Athleten in einem Sporthemd von „schwindsüchtiger“ (so nannte Apollinaire diese rosa Farbe) Farbe in seinem Relief der nackten ockerfarbenen Landschaft ähnlich; das Mädchen ist jedoch mit dem verblassten Himmel über dieser Wüste durch die ausgeblichene blaue Farbe seines Trikots und seine Geste einer Karyatide verbunden. Im übrigen kann man ihre Position (wie die Position des Kubus oder der Kugel) auf verschiedene Weise deuten, weil das Thema des Gemäldes hier so weit reduziert ist, dass das einfache Ereignis im Gemälde als ein geheimnisvolles Ritual erscheint. Undurchsichtig ernst, wie eine Statue, ist der kolossale Athlet; rätselhaft ist das Halblächeln der Akrobatin mit der rosa Blume im Haar; abstrakt ist die Gegend, die an die Berglandschaften im Süden Spaniens erinnert.
Aber vor diesem noch ganz literarischen Hintergrund kündigt sich im bildhaften Denken Picassos bereits die dringende Notwendigkeit einer Erneuerung der formalen Sprache seiner Kunst an. Wenn auch die Rätselhaftigkeit des Gemäldes durch die Unklarheit des Themas erreicht wird, so geht jene Poesie, die als einzige dem Ensemble der untereinander kontrastierenden gestalterischen Elemente des Gemäldes eine Ganzheit verleiht, schon nicht mehr vom Sujet, von der Idee oder dem Gegenstand der Darstellung aus, sondern von den linearen, plastischen, räumlichen Beziehungen, dem Leben der Formen. Natürlich wird in diesem Bild aus der ersten Hälfte des Jahres 1905 das Problem der Form erst angedeutet, aber bereits hier werden ihre Gewaltigkeit, Kompliziertheit und ihre Möglichkeiten spürbar. Gerade deshalb ist in der Reihe der schöpferischen Ideen Picassos Mädchen auf der Kugel der Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung zur Plastik und zur Bildhaftigkeit.
Die Sorge um die Form im Zusammenhang mit einem großen Gemälde beherrscht Picasso im Lauf der ganzen Zirkusperiode bis zum Herbst 1905, als das Hauptgemälde Gauklerfamilie endlich vollendet war. Zwei Skizzen zu diesem Bild, Gauklerfamilie und Die Spanierin von Mallorca, illustrieren nicht nur die thematische Entwicklung des Gemäldes, sondern auch die Richtung des formalen Suchens Picassos. In der Gauklerfamilie, der Studie zu der Gesamtkomposition, sind fünf Komödianten und ihr Hund dargestellt, die bereit sind, ihre Wanderung wieder aufzunehmen. Ihre Zugehörigkeit zum artistischen Beruf ist durch die Zirkuskleidung bezeichnet, und die Erhabenheit über die Welthast wird allegorisch durch das rasende Galoppieren der Jockeys hinter ihnen unterstrichen. Aber die dynamische Szene auf der Rennbahn ist hier auch nötig, um die Bedeutung der Gruppe der Zirkusartisten hervorzuheben. Wahre Monumentalität erreichte diese Komposition, die im wesentlichen auch auf das große Gemälde übertragen wurde, jedoch erst in ihrem Endzustand, indem sie sich von den realen Anspielungen der Skizze befreite und sich mit der Poesie einer unvollendeten Geschichte und einer beunruhigenden Grenzenlosigkeit des Raumes füllte.
Im Jahr 1912 fand der deutsche Autor Ludwig Kellen bei einer der ersten kritischen Übersichten des Schaffens von Picasso eine neoplatonistische Erklärung für Picassos Interesse an den Problemen des Raumes: Der reine Raum ist das, woraus alle Farben und Formen wachsen, wo das geistige Wesen aller Erscheinungen zur Welt kommt.[49] Aber weder im Jahr 1905 noch später (wie seine eingeweihten Freunde ausdrücklich unterstreichen) kümmerte sich Picasso um die Ideen der philosophischen und physischen Erkenntnis. Doch als Künstler, der mit visuellen und wahrnehmbaren Formen der Welt operiert, und als lyrischer Dichter, der von einer tief erlebten persönlichen Erfahrung ausgeht, begriff er unbewusst den Zusammenhang von Raumtiefe und Geistigkeit, empfand er den Raum als eine Spielarena der geistigen Kräfte. (Nicht umsonst widmete einer der geistvollsten Dichter, Rainer Maria Rilke, der Gauklerfamilie eine Elegie, in der auch die sehnsüchtigen Töne der Frage Gauguins: „Woher?… Wer?… Wohin?…“ anklingen.[50])
Das Interesse für die räumliche Form wurde bei Picasso von den Bedürfnissen seiner Kunst selbst diktiert, von seinem Verfahren des Ausdrucks. Doch das nicht allein. Dieses Interesse deutete zugleich ein verborgenes Phänomen der neuen räumlichen Ausweitung seines Bewusstseins an, denn die Frage „Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir?“ richtet sich immer beharrlicher an ihn selbst: Woher komme ich?
Vom Standpunkt des Individualisierungsprozesses ist die Frage nach der geistigen Selbstbestimmung zwangsläufig notwendig für die folgende Phase des Werdens seiner Persönlichkeit, die der vierundzwanzigjährige Picasso durchlebte. Und gerade dieses unbewusste, intuitive Suchen nach seinen inneren Wurzeln wird zur psychologischen Grundlage für jene neue Richtung in der Kunst Picassos, die man zuerst antiken Einflüssen zuschrieb und den rosafarbenen Klassizismus der Jahre 1905-1906 nannte, jetzt tiefer und breiter interpretiert, als „Rückkehr zu den mediterranen Quellen“.[51]
Es ist nicht zufällig, dass diese Rückkehr nach dem Hollandaufenthalt Picassos im Sommer 1905 besonders klar hervortrat, wo er mit einem ihm völlig fremden Land in Berührung kam und Bilder mit zurückbrachte, die voller ethnographischer Neugier sind. Eines der ersten Anzeichen der Rückkehr zu den Mittelmeerquellen waren der zu Ende gemalte spanische Landschaftshintergrund in dem Washingtoner Gemälde Gauklerfamilie und die etwas entfernt von der Hauptgruppe untergebrachte sogenannte Spanierin von Mallorca.
Diesen Namen hat die rätselhafte Gestalt aus der oben erwähnten Moskauer Studie erhalten; er taucht bereits 1913 in dem Katalog von Stschukin auf. Die Bedeutung dieser Gestalt in dem Washingtoner Gemälde lässt sich nicht eindeutig interpretieren, aber der schöne klassische Tonkrug neben der rätselhaften Gefährtin der Komödianten lässt ihre Zugehörigkeit zur Welt der Mittelmeerkultur ahnen.
In der Moskauer Studie gibt es dieses Attribut der Klassik noch nicht, und doch illustriert sie mit ihren Farben des Himmels, dem lichten Ocker und der weiblichen Halbfigur ganz das vollkommene Bild des Mittelmeeres.
Diese so unspanische Spanierin mit der traditionellen Haartracht unter dem Schleier erinnert an die Terrakotten von Tanagra. In ihr ist die harmonische Gliederung der Proportionen, die erhabene Würde, der ferne Reiz des antiken Ideals lebendig. Doch in ihren auserlesenen Linien und der Tonverfeinerung spürt man noch nicht das wahre, rein plastische Erleben der Form, von dem Picasso ergriffen war, als er in die Tiefen der mediterranen Quellen seiner künstlerischen Natur vordrang.
Parallel dazu werden aus seiner Kunst die hieratisch-rätselhaften Figuren des Herbstes 1905 verschwinden (zu deren Familie auch die Moskauer Spanierin von Mallorca gehört), und die zwingende Idee der Quellen wird ihn zu den Themen der natürlichen Nacktheit und der Jugend bringen. In der bildhaften Vorstellung Picassos werden diese Themen im Winter 1905/1906 in der Grundidee einer neuen großen Komposition mit fünf nackten Jungen und Pferden an der öden Mittelmeerküste vereint. Aber statt einer mehrfigurigen Komposition, die im Stadium einer detaillierten Skizze belassen wurde (bekannt unter dem angenommenen Titel Die Tränke, malte Picasso auf einer Zweimeterleinwand (die vielleicht für diese Komposition vorausbestimmt war) lediglich den Knaben, der ein Pferd führt. Diesen Skizzen zugehörig scheint auch als unabhängige Studie Der nackte Knabe aus der Ermitage zu sein, die Studie eines vorgestellten Modells, einer Art idealen Jünglings, genauer eines mannbar werdenden Halbwüchsigen; sein Körper steht bereits in voller Jugendblüte, seine geistige Kraft ist jedoch noch nicht erwacht, und so befindet er sich, von der körperlichen Reife beschwert, in einem Stadium lässiger Sehnsucht der Untätigkeit. Picasso strebte danach, die Figur fest und unverrückbar hinzustellen, wie eine Statue, trotz ihrer schlaffen fließenden Pose, ihrer Schwergewichtsverlagerung und des die Formklarheit auflösenden hellen Tons. Er macht die Proportionen schwerer, fesselt die leichte, fließende Silhouette durch eine klare federnde Kontur, verwendet eine Schicht von weißer Gouache in ihrer ganzen materiellen Dichte.
Und während die körperliche Substanz des nackten Jungen an den warmen griechischen Marmor erinnert und die plastische Klarheit an das Ideal der antiken Harmonie, steht sein fest gebauter Körper mit den großen Händen und Füßen weniger dem klassischen Typ als der körperlichen Schönheit von Bauernjungen näher, den zeitgenössischen Nachkommen der uralten Mittelmeerrasse, die Picasso im Sommer 1906 in der Siedlung Gosol in den spanischen Pyrenäen sehen wird.
Der Aufenthalt in Spanien ist an und für sich recht vielbedeutend in dieser Periode der Rückkehr zu den Mittelmeerquellen, und der Aufenthalt in Gosol, einem abgelegenen Dorf im Hochgebirge bei Andorra, ist doppelt bedeutsam, denn er zeigt welcher Art diese Quellen waren und von welchen Erlebnissen jene Begeisterung für die iberische Archaik herrührte, die Picasso im Herbst 1906 wieder in Paris ergriff.
Für Picasso war Gosol wahrscheinlich das zweite Horta de Ebro, wo er etwa ein Jahr als Siebzehnjähriger verbracht hatte und, nach seiner eigenen Bekenntnis, alle Erkenntnisse über das Leben erfahren hatte. Die raue, strenge Natur der Ostpyrenäen, dieses Hirten-und-Schmuggler-Landes, ein Leben unverändert seit den Zeiten des Heidentums, offenherzige und harte Charaktere, die sich in den Gesichtszügen ausdrücken, der sichere Gang und die gerade Haltung der gut gebauten Gestalten — das ist das Bild des katalonischen Arkadiens Picassos, in das er sich sofort einlebte.
„In Spanien erlebte ich ihn als einen anderen Menschen“, erinnerte sich ein Vierteljahrhundert später Fernande Olivier, „oder eher als einen, der dem Pariser Picasso nicht ähnelte, er war klarer, weicher als sonst, beweglicher und lebendiger, entgegenkommender, ruhiger und selbstsicherer, mit einem Wort — glücklicher. Er strahlte vor Glück — im Gegensatz zu seinem gewöhnlichen Aussehen und Verhalten.“[52]
Hier, in der ockerfarbenen Gebirgslandschaft, die des Grüns fast völlig entbehrte (so erstaunlich im Mädchen auf der Kugel, in der Gauklerfamilie und der Tränke vorausgespürt), vor dem Hintergrund der vielfältigen Formlosigkeiten einer wilden Natur spitzt sich das Gefühl für die einfache, aber harmonisch und vernünftig gebaute Form zu, sei es für die Gestalt eines Menschen oder das Produkt seiner Hände. Indem er in Gosol das Thema der jugendlichen Nacktheit fortsetzte und vertiefte, geht jetzt Picasso nicht so sehr von der Ephebengestalt, sondern von vereinfachten plastischen Formen aus, die als ein Knabe, eine Frau, ein Porträt oder als Tongegenstände zum Hausgebrauch gedacht werden. Aber jede dieser plastischen Ideen lebt das Leben einer Gestalt, die voll unbefangenen Charmes ist.
Stillleben mit Porron (Das Glasgeschirr), 1906. Öl auf Leinwand, 38,4 x 56 cm. Ermitage, St. Petersburg.
So das anspruchslose Stillleben mit Porron mit vier Gebrauchsgegenständen aus dem bäuerlichen Alltag: zwei Glas- und zwei Tongegenstände. Dieses höchst einfache Motiv einer auf die Art von Zurbarán frontal entfalteten Gruppe von Gegenständen lebt von dem dynamischen Zusammenspiel der Kontraste und Ähnlichkeiten in Aufbau, Volumen, Plastik, Rhythmus und Farbe. Dabei spürt man in der Gegenüberstellung der individuellen Charaktere der graziösen Karaffe und des dreieckigen Porrons, des bauchigen Töpfchens mit dem Deckel und des einfachen Tonkruges jenen versteckten Humor des Verwandlungsspiels, der der schöpferischen Phantasie Picassos eigen ist und aus der objektiven Darstellung unbelebter Natur eine Genresituation macht: das Treffen von zwei Paaren auf der Bühne eines gewöhnlichen Tisches: eines aus Glas und eines aus Ton. Bereits in den Arbeiten von Gosol — das wird in dem Stillleben mit Porron deutlich — reifen unbewusst, aber logisch zwei Grundlinien einer weiteren Entwicklung der formellen Konzeption heran: die Betonung der ursprünglichen ausdrucksstarken Einfachheit einzelner Formen und die Komplikation der Kompositionsstruktur des Ganzen.
Stilistische Gestaltung werden diese Grundlinien in Paris im Laufe des Herbstes 1906 gewinnen, einerseits in der Berührung mit der archaischen iberischen Skulptur des ersten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung, die kurz davor von Archäologen entdeckt und seit dem Frühjahr 1906 im Louvre ausgestellt wurde[53], andererseits in der Begegnung mit der Malerei El Grecos, die er mit neuen Augen als eine hauptsächlich visionäre Kunst ansah. Dass diese beiden Modelle, bei all ihrer Gegensätzlichkeit, spanisch sind, musste unter dem Aspekt seiner Rückkehr zu den Quellen, seiner Suche nach den eigenen iberischen Wurzeln für Picasso einen besonderen Sinn erhalten.
Gosol war für Picasso die Welt des ersten Schöpfungstages. Hier, entfernt von den Kulturzentren, musste er die Relativität und die Willkürlichkeit nicht nur der von der akademischen Bildung aufgepfropften Kunstkniffe, sondern auch der allgemeingültigen kulturellen Normen und der ganzen dahinter stehenden europäischen Tradition erkennen. In dieser Welt der Ursprünglichkeit und der Nacktheit wurde jede Geste des Malers, jede Berührung mit dem formlosen Stoff mit ungewöhnlicher Schärfe spürbar. Gerade hier konnte Picasso vollkommen die hinter der Form stehende Tiefe menschlicher Erfahrung, die Intensität geistiger Arbeit erleben, die Formen schafft. Andererseits war das künstlerische Denken Picassos sehr konkret, gegenständlich, und die Formen selbst waren für ihn durchaus keine abstrakten Formen an sich; sie waren Ausdruck seiner Haltung den Dingen gegenüber.
Im Sommer 1906 gewinnt in Gosol für Picasso die weibliche Nacktheit ungewöhnliche Bedeutung, eine gewisse entpersonalisierte, ursprüngliche, einfache Nacktheit, wie der Begriff „Frau“ selbst. Ob die weiblichen Akte aus Gosol Picassos Antwort auf das im Herbstsalon 1905 ausgestellte Türkische Bad Ingres’ waren oder nicht[54] — die Frage bleibt offen.
Aber vom Standpunkt der inneren Welt des Künstlers ist ihre Bedeutung zweifellos größer und mehr als nur eine rein künstlerische Reaktion, das bestätigt auch die Rolle, die die weiblichen Akte in den Sujetabsichten Picassos der nächsten Zukunft spielen. Vor allem die Komposition eines großen Gemäldes, an dem er im Winter und Frühjahr 1906 arbeitet und das später die Benennung Les Demoiselles d’Avignon erhielt (Museum of Modern Art, New York).
Aus der Furcht vor einer Typhusepidemie verließ Picasso Gosol eilig und kehrte kurz geschoren nach Paris zurück. Mag sein, dass dieser Umstand ihn anregte, sich in dem bekannten Selbstbildnis vom Herbst 1906 als kindlich jungen „Maler Adam“ darzustellen, so wie er sich selbst empfand. Der Blick des „Malers Adam“ mit vor Kraft strotzenden Torso und Händen wird nicht auf das Äußere gerichtet, er strebt nach innen. Sein Gedanke ist metaphorisch dargestellt mit vierfarbiger Palette: schwarz, ocker, weiß und rosa; ein großer Teil der Palette ist leer — die Arbeit steht noch bevor, aber das koloristische Credo ist zu spärlich für die Wiedergabe von flüchtigen und verführenden Wahrnehmungen.
Picasso ähnelt hier einem Foto, das ihn im Alter von 15 Jahren zeigt, und diese Projektion seiner selbst als Halbwüchsiger in die Gegenwart zeugt davon, dass er sich als einen neuen, das Leben jetzt erst beginnenden Menschen versteht.
Das, so scheint es, war das Ergebnis seiner Rückkehr zu den Mittelmeerquellen, zu den iberischen Wurzeln seiner künstlerischen Existenz.
Am 25. Oktober 1906 wurde Picasso fünfundzwanzig. In diesem Moment rundet sich der Zyklus des Werdens seiner Persönlichkeit ab. Während er im Frühjahr 1907 an dem Gemälde Les Demoiselles d’Avignon arbeitete, kommt er als Maler neu zur Welt.
In den Sammlungen der Museen von Moskau und St. Petersburg gibt es nur eine Arbeit, die diesem entscheidenden Moment der künstlerischen Karriere Picassos zuzurechnen ist, Weiblicher Halbakt. Die Besonderheit dieser Periode besteht darin, dass zu viele bedeutende Erlebnisse sich in der kurzen Zeitspanne von einigen Monaten konzentrierten und keine der Arbeiten, die fast keine eigentlichen Kunstwerke mehr sind, sondern biographische Begebenheiten widerspiegeln, ist imstande, ein wahrheitsgetreues Bild des Ganzen zu geben. Nur aus der Gesamtheit aller — und das sind mehrere Dutzende — im Frühjahr 1907 geschaffenen Bilder, Skizzen, Zeichnungen, Entwürfe in Notizblöcken, Skulpturen, also aus der Gesamtheit des Ausdrucks des Malers, kann eine Geschichte der „zweiten Geburt“ Picassos rekonstruiert werden, die trotz mancher Interpretationsversuche längst noch nicht verstanden wurde. Die gesamte Konzeption der radikalen Wendung des Jahres 1907 jedoch, ihr Wesen und ihr Verlauf erklären sich weder aus den Hinweisen auf Einflüsse (iberische, afronegroide, von Cézanne, El Greco, Ingres) noch aus den Lehren Derains, aus der Polemik mit dem Fauvismus von Matisse, aus bestimmten philosophischen oder literarischen Tendenzen oder aus anderen allgemeinen Nebenumständen.
Natürlich war der jungen Künstlergeneration des Anfangs des 20. Jahrhunderts der Geist der Avantgarde, des ästhetischen Radikalismus eigen. Dennoch war sogar der Führer der Wilden, Matisse, empört über die Les Demoiselles d’Avignon und bezeichnete das Gemälde als Misshandlung der modernen Kunst, denn er konnte für dieses Bild keine ästhetisch rechtfertigende Erklärung finden. War diese Arbeit (zumindest damals) moderne Kunst? Auf jeden Fall erschien dieses Gemälde den ersten Betrachtern als etwas Assyrisches (so bezeichnete es Wilhelm Uhde) gegenüber Kahnweiler. Der Zöllner Rousseau äußerte bekanntlich im Jahre 1908, dass Picasso im „ägyptischen Genre“ arbeite.
Inzwischen ist eindeutig geklärt worden, dass Picasso während der Arbeit an den Les Demoiselles d’Avignon zwei iberische Steinskulpturen besaß, die er bei seiner Suche „um Rat fragte“. Mit der eigentlichen zeitgenössischen Malerei von Paris hatte er seit 1901 keine schöpferische Verbindung mehr, seit dem Beginn der Blauen Periode ging er seinen eigenen einsamen Weg. Sogar auf den skandalösen Triumph des Fauvismus im Herbstsalon 1905 antwortete seine Kunst mit Schweigen; sie trat damals in die überaus harmonische und antiavantgardistische Phase des Rosaklassizismus ein.
Picasso war immer ein einsamer Künstler, „er war immer frei, niemandem verpflichtet als sich selbst“ (Kahnweiler). Aus der Distanz von über vier Jahrzehnten hat der Maler die Gründe und das Wesen seiner schöpferischen Wendung von 1907 so erklärt: „Ich sah, dass alles getan war. Man musste sich überwinden, eine eigene Revolution vollbringen und bei Null beginnen.“[55]
Aber diese Wendung, diese Revolution war weder momentan noch leicht. Sie vollzog sich unter den Bedingungen der neuen geistig-psychologischen Krise, einer viel tieferen und umfassenderen als je zuvor, weil sie die technischen, geistigen und gestalterischen Möglichkeiten der Malerei betraf („Ich sah, dass alles getan war…“), sie betraf die Zukunft Picassos als Maler und damit seine persönliche Existenz.
Es war eine einsame innere Revolution, und niemand, außer Apollinaire vielleicht, der ein Jahr später eine analoge Wendung durchmachte, verstand das gut. In seinem Buch Maler-Kubisten (1913) verallgemeinerte Apollinaire seine und Picassos Erfahrung in der Theorie des schöpferischen Schaffens, die sich auf ein recht sonderbares Kriterium stützte — Müdigkeit.
„Es gibt Poeten, denen die Muse ihre Lieder diktiert; es gibt Künstler, deren Hand ein Unbekannter führt, der sie gleichsam als Instrumente verwendet. Solche Maler fühlen nie Müdigkeit, denn sie arbeiten nie, und sie können Tag und Nacht hindurch produzieren, zu jeder Stunde, an jedem Tag, zu jeder Jahreszeit, in jedem Land; das sind keine Menschen, sondern poetische oder künstlerische Instrumente. Sie kann der Verstand nicht stören, sie erleben keine Anstrengung, und ihre Arbeiten zeigen keinerlei Anzeichen von Kampf; sie kämpfen ja auch nicht. Sie sind nicht göttlich und können ohne sich selber auskommen. Sie sind wie eine Verlängerung der Natur, und ihre Werke gehen nicht durch den Verstand. Sie sind imstande, die Seele zu rühren, ohne die zum Leben erweckten Harmonien zu vermenschlichen. Andererseits gibt es Poeten, Maler, die sich in einem ständigen Schaffensprozess befinden, die, obwohl der Natur zugewandt, nicht direkt nach der Natur schaffen; sie müssen alles aus ihrem Inneren hervorholen, und kein Dämon, keine Muse inspiriert sie. Sie leben einsam und drücken gar nichts aus, es sei denn, dass ab und zu in ihnen etwas rauscht, nach außen drängt, und sie unternehmen eine Anstrengung nach der anderen, einen Versuch nach dem anderen, um allein das zu formulieren, was sie formulieren wollen. Menschen, die nach dem Muster Gottes geschaffen sind, auch sie werden sich einmal erholen und dann ihre Schöpfungen bewundern. Aber wieviel Müdigkeit, wieviel Unvollendung, wieviel Plumpheit?!
Picasso war ein Maler, der den ersteren glich. Und noch nie war ein Anblick so phantastisch, wie diese Metamorphose der von ihm durchlittenen Verwandlung in einen Maler, der jener zweiten Katergorie ähnelte.“[56]
Wenn man die Etappen und die Verwandlungen des Konzepts und der Komposition seines künftigen epochalen Gemäldes Les Demoiselles d’Avignon verfolgt, den Lösungsweg seiner Einzelgestalten, erkennt man hinter den parallel entstehenden Ideen und Bildern Hinweise darauf, wie Picasso selbst, indem er „formuliert, was er formulieren will“, den schöpferischen Prozess kritisch untersucht, wie er beharrlich seine zu sehr an Virtuosität, an einen gewissen Automatismus der Meisterschaft gewöhnte Hand in eine andere Richtung zwingt. „Noch nie war die Arbeit weniger mit Freude belohnt worden“, schrieb Salmon[57], der damals Picasso in einem bedrückten, verworrenen, gereizten Geisteszustand antraf; Derain schloss sogar die Möglichkeit des Selbstmordes nicht aus.[58]
Weibliche Halbfigur. Studie zu „Les Demoiselles d’Avignon“. Öl auf Leinwand, 65 x 58 cm. Centre Georges Pompidou, Paris.
Aber die Einsamkeit und Abgeschlossenheit Picassos wirkten sich nicht demoralisierend auf ihn aus. Er sagte später, bei der Erinnerung an diese Zeit, dass ihn die Arbeit gerettet habe. Und tatsächlich, der Wille oder die Intention des Schaffens überwand die Unbestimmtheit des Ziels bei der Arbeit an den einfachsten Studien und „Akademien“, jeder folgende Schritt war eine neue Stufe zum Ungewissen, jeder neue Schritt brach mit dem Status quo durch das Überschreiten der Grenzen des Gegebenen, durch die Erweiterung seiner Möglichkeiten.
„Aber wieviel Müdigkeit, wieviel Unvollendung, wieviel Plumpheit!?“ Was aber wurde von Picasso gewonnen um den Preis des so problematischen Vergessens (wie es Apollinaire nannte) seiner einstigen Art zu sehen, die ihm von der klassischen gestalterischen Tradition anerzogen worden war? Eine neue Auffassung von den bildenden Künsten, deren formale Sprache in genau dem gleichen Verhältnis zu den Formen der real visuellen Welt steht wie die poetische Sprache zur alltäglichen Rede.
Im Jahre 1907 entdeckte Picasso, was bereits im Thema der Blindheit in der Blauen Periode vorausgeahnt wurde: Der Künstler besitzt ein inneres Auge der Vorstellung, das emotional sieht und spürt (Penrose), und deshalb ist es für den Maler wichtig (wie er Jahre danach Kahnweiler sagen wird) „zu erkennen, dass die von uns gesehene Welt ein Nichts ist“.[59]
Indem er sich in seiner Werkstatt von der Außenwelt abschloss, gewohnheitsmäßig nachts arbeitete, schulte Picasso sich und seinen Geschmack konzentriert und beharrlich um, erzog er seine eigenen Gefühle um. Es ist nicht zufällig, dass fast allen Arbeiten des Jahres 1907 der Charakter einfachster Schulaufgaben eigen ist: Studien nackter Figuren, Halbfiguren, Köpfe, Stillleben; und nicht umsonst wurden alle diese Figuren ohne Modell, nach der Phantasie angefertigt. „In jener Zeit arbeitete ich ohne jegliches Modell. Was ich suchte, war etwas ganz anderes“, sagte er Daix.[60] Er suchte nach neuem Ausdruck, aber nicht im Sujet, Motiv, Gegenstand an sich, sondern in den Linien, Farben, Formen, in Pinselstrichen und den Strichen selbst, die in ihrem eigenen und nicht im nachahmenden Sinne verstanden werden — in der kraftvollen Wirkung der malerischen Schrift aus sich selbst heraus.
Hier stützte er sich auf die vor- und außerklassische bildliche Erfahrung der Menschheit: auf die archaischen, primitiven und barbarischen künstlerischen Systeme, die seinem eigenen Empfinden nahe waren. Die Plumpheit, beinahe Monströsität einiger Darstellungen des Jahres 1907 diente einerseits der Umerziehung der Gefühle, entsprach andererseits den bildlichen Vorstellungen Picassos jener Zeit, indem sie nicht nur die Emotionalität der Wahrnehmung aktivierte, sondern auch dem Bild dank der archaischen und barbarischen Assoziationen eine gewisse Atmosphäre der Vorzeit, eine Art Hintergrund der Ewigkeit verlieh. In einem größeren Maße jedoch kann man diese Plumpheit auch auf das Pathos der expressiven Destruktion zurückführen, das dem revolutionären Geist Picassos 1907 eigen war. André Malraux erinnerte sich an Picassos Worte über die Notwendigkeit, „immer dagegen arbeiten, sogar gegen sich selbst“,[61] und, wie es scheint, war auch das eine Entdeckung jener Zeit.
Hier trifft der Vergleich mit Arthur Rimbaud zu, der, um den Preis der Verwirrung aller seiner Sinne, unter heroischen Anstrengungen aus seiner Haut und seiner Epoche zu entfliehen suchte, um das klare Sehen zu gewinnen, d. h. die Macht und die Freiheit des schöpferischen Geistes, der nicht von den routinemäßigen Formen des poetischen Sehens gefesselt ist. Das Ungewisse war auch das Gebiet seines Strebens, und die Neuheit erkannte er als den wichtigsten Wert. (Erinnern wir daran, dass auch Majakowski die Poesie als eine Fahrt ins Ungewisse bezeichnete). Aber im Unterschied zu Rimbaud, dem „Kind, das zu früh vom Flügel der Literatur angerührt wurde“ (Mallarmé), der scheiterte und sich von der Kunst lossagte, gelangte Picasso zu seiner Revolution, als habe er zuvor das Leben mehrerer Maler durchlebt, indem er verschiedene Phasen des Wachsens in seinen Perioden durchmachte (auch deswegen sprach Apollinaire vom Vergessen nach dem Erlernen). Zudem bestand die Sprache Picassos aus konkreten visuellen Formen und nicht aus der ephemerischen Materie des Wortes, die gleich empfänglich für die Empfindungen wie für die Begriffe ist und die leicht die Einbildung in den Bereich der Theorie, der rein intellektuellen Abstraktionen führt.
Es scheint aber, dass Picasso gerade damals über den Effekt der Wirkung vor allem des Wortes auf die Phantasie nachdachte: Indem wir Buchstaben sehen und Worte hören, erblicken wir mit dem inneren Auge die Bilder, empfinden die Emotionen, die von ihnen erzeugt werden. Wenn aber im wesentlichen die Malerei und die Poesie dasselbe sind, so sind auch visuelle Elemente, die vom alltäglich Beschreibenden gereinigt und in ihrer ganzen suggestiven Kraft eingesetzt werden, imstande, Metaphern zu bilden, ähnlich den von Worten gebildeten Metaphern, in der poetischen Empfindung neue, noch nie gesehene Bilder, neue, ergreifende Empfindungen zu erzeugen.
Im Jahr 1918 wird Apollinaire schreiben: „Die formale Suche gewann von nun an eine gewaltige Bedeutung. Und sie ist gerechtfertigt. Wie kann diese Suche dem Dichter gleichgültig sein, wenn sie imstande ist, neue Entdeckungen in der Welt des Denkens und in der Lyrik auszulösen?“[62]
Im Jahr 1907 fand Picasso, ständig auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen, in seiner neuen Bildsprache mannigfaltige Sinnesschattierungen, die durch ihre Lebenskraft und ihren Psychologismus überraschen.
Das Gesicht des Weiblichen Halbaktes aus der Ermitage ist unpersönlich und schematisch wie eine Maske. Dabei aber wirken die leichte Kopfneigung, die geschlossenen Augen und andere feinere mimische Schattierungen so, als drückten sie einen Zustand lyrischer Selbstbetrachtung oder schlummernder Ruhe aus. Die gelassenen und sinnvollen Wechselverhältnisse der warmen Töne und eine pastös zusammenhängende Dichte der farbigen Materie entsprechen sowohl dem „seelischen Zustand“ der Gestalt als auch der geometrisch klaren Einfachheit des plastischen Aufbaus des Gemäldes im Ganzen.
Zu den großen bildlichen Offenbarungen des Jahres 1907 gehören so bekannte Meisterwerke aus der Ermitage-Sammlung wie Tanz mit Schleiern und das Stillleben mit Schädel.
Der Titel Tanz mit Schleiern ist reinste poetische Willkür, denn in Wirklichkeit ist es ein vor dem Hintergrund akademisch konventioneller Drapierungen dargestellter weiblicher Akt in der akademischen Pose des Kontrapostes, der in jeder Modellklasse aufgestellt wird. Aber trotz der Statik der entspannten und sogar etwas träumerischen Pose der Figur selbst ist die ganze Gestalt des Gemäldes von solch mannigfaltigen und dynamischen Energieströmungen durchdrungen, dass dabei eine unwillkürliche Assoziation mit dem Tanz entsteht:
„Im Wehen ihrer schimmernden Kleider,
im Gleiten der Schritte ist die straffe Schwingung
einer tanzenden Schlange…“
(Baudelaire, Les Fleurs du Mal, XXVII).
Im Grunde genommen kehrt Picasso im Tanz mit Schleiern (wahrscheinlich, ohne es zu bemerken) zu den plastischen Ideen des Mädchens auf der Kugel zurück — das Dreieck, das auf die Spitze gestellt ist und nur knapp auf einer runden Form im Gleichgewicht gehalten wird (dort eine Kugel, hier ein konkaver Bogen); aber während sich in dem Gemälde des Jahres 1905 nur die junge Akrobatin in labilem Gleichgewicht befindet, wird in dem Gemälde des Jahres 1907 die Konstruktion des ganzen Gemäldes, die beunruhigenden Rhythmen der Linien, der Aufbau und die Farbgebung, mit einem Wort, die Form, von der intensiven Dynamik des Gleichgewichts ergriffen. Den Gesetzen der klassischen Tektonik zuwiderlaufend, greift Picasso zu einem Effekt, der besonders scharf die Wahrnehmung betrifft: zu dem Eindruck der Labilität, die eine tiefe, organische Unruhe einflößt. Aber gleichzeitig verleiht gerade die Form der Figur und dem Hintergrund eine malerisch-dynamische Einheit trotz der Destruktivität der in ihr steckenden plastischen Ideen und der disharmonischen Polychromie, trotz aller ihrer inneren Konflikte. Die Spannung der Form ergreift sofort den Betrachter, da sie als das eigentliche Thema des Gemäldes empfunden wird. Das Sujet ist rein visuell, und obwohl es sich in formalen Fachausdrücken analysieren lässt, kann man Eindrücke von diesem Formsujet nicht in einer wörtlichen Beschreibung wiedergeben, das wie ein Strohkorb geflochten scheint und gleichzeitig das raffinierte Leben eines Diamanten lebt, der durch seine Strahlkraft überrascht (Salmon).
Im Tanz mit Schleiern vermeint man traditionell, aber unbegründet, die afronegroiden stilistischen Einflüsse zu erblicken, indem man auch das ganze Jahr 1907 die Negroperiode nennt. Aber die „Barbarei“ Picassos des Jahres 1907 ist nicht ethnographischer, sondern negativistischer Natur, „dem dagegen arbeiten, sogar gegen sich selbst“, wie er es später formulierte. Polemisch gegen die europäische Tradition der Malerei eingestellt, ist Tanz mit Schleiern buchstäblich von vielfältigen Assoziationen durchdrungen, die aus dieser Tradition herrühren, aber noch häufiger in Widerspruch zu ihr stehen. Sogar ohne zu wissen, dass Picasso während der Arbeit an der Leinwand aus der Ermitage eine Kopie der Großen Odalisque von Ingres in derselben farbig-schraffierten Manier anfertigte, kann man einen Zusammenhang mit der durch ihre große Linie so bekannten Ingresschen Quelle erkennen. Und der energisch gesättigte Aufbau des farbigen Graphismus verweist den Betrachter direkt zu der expressiven, spontanen malerischen Technik van Goghs. Die Verbindung — die direkte und rückläufige — mit der europäischen darstellenden Tradition ist nicht nur sichtbar, sondern sie steckt gleichsam im Programm des Stillleben mit Schädel, die man nicht umsonst als eine eigenartige Variation Picassos zum Vanitas-Thema behandelt, das in der alten Malerei so verbreitet ist. Tatsächlich werden die Palette mit den Pinseln, das Gemälde, die Bücher und die Pfeife in Verbindung mit dem Schädel, dem traditionellen Symbol der Vergänglichkeit des Lebens, allegorisch wahrgenommen als die diesem Genre eigenen Attribute der intellektuellen und sinnlichen Vergnügungen.
Gleichzeitig sind Pfeife, Bändchen mit Gedichten, Palette, Pinsel, Gemälde, genau wie auch der menschliche Schädel, gewöhnliche Gegenstände in der Werkstatt eines Malers, und ihre Mischung ohne Ordnung ist für die eigene Werkstatt Picassos im „Bateau-Lavoir“ typisch (und auch in allen anderen, die er belegte). Doch nicht der Geist der weisen Belehrung, des ethischen Philosophierens („denke an den Tod“, „alles ist Eitelkeit“) geht von diesem Stillleben aus. Im Gegenteil, in der düsteren Erregtheit seiner kalten Töne, in dem Zusammenstoß und den Bruchstellen der scharfen, stechenden Ebenen, in den ungestümen Stürzen der Diagonalen spürt man die traurige Exaltation des ausgesprochen persönlichen Ausdrucks. Einem riesigen Barren alten Goldes ähnelnd, verleiht der menschliche Schädel den metaphorischen Bedeutungen der Form nur die Endbestimmtheit — es ist ein Requiem.
Aber vielleicht ein etwas ungewöhnliches, da auf dem Vordergrund „von Angesicht zu Angesicht“ mit dem Schädel ein so prosaischer Gegenstand wie ein leeres Haushaltsgefäß — ein Eimerchen? ein Topf? — hingestellt ist, das noch deutlicher und nachdrücklicher in der Skizze markiert ist. Der Komposition nach ist dieser Gegenstand nicht weniger bedeutend als der Schädel; aber nur kompositorisch, denn in der traditionellen Ikonographie des Vanitas-Themas ist er nicht vorgesehen; aber auch für die unorthodoxe Einbildung Picassos musste so eine Extravaganz in solch einem ernsten Kontext eine besondere inhaltliche Bedeutung haben. Sprechen die Bedeutsamkeit des Sujets und die bewegte Intonation des Autors von einem tief persönlichen Anlass zum Malen des Stillleben mit Schädel, so ist ihre Widmung in der Darstellung dieses Gefäßes chiffriert. Sie offenbart sich durch ein Wortspiel: der Tontopf, Jarre, als eine Widmung an Alfred Jarry, den Literaten, dessen frühzeitiger Tod am 1. November 1907 Picasso nicht gleichgültig lassen konnte. Dabei mangelt das Nebeneinander- und Gegenüberstellen in der Memoirenkomposition des Schädels und des Tontopfes als zweier leerer Gefäße nicht an tragischer Groteske und ist voll von kummervollem Pathos. Neben der Trauer des Künstlers findet sich hier noch eine Anspielung auf die ungewöhnliche Persönlichkeit des Verstorbenen, auf die Mentalität und den Tod Alfred Jarrys, dieses Enfant terrible der Literatur.
Weibliche Halbfigur. Studie zu „Les Demoiselles d’Avignon“, 1906-1907. Öl auf Leinwand, 58,5 x 46 cm. Musée Picasso, Paris.
Tanz mit Schleiern (Weiblicher Akt mit Draperie), 1907. Öl auf Leinwand, 150 x 100 cm. Ermitage, St. Petersburg.
Stillleben mit Schädel, Entwurf, 1907. Aquarell, Tinte, Kreide auf Papier, 32,5 x 24,2 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.
Freundschaft, Entwurf, 1908. Aquarell, Tinte auf Papier, 63 x 47,7 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.
Es ist ungenügend, die revolutionäre Wendung des Jahres 1907 nur als die Suche nach den nicht traditionellen formalen Lösungen der traditionellen Kunstthemen zu verstehen, nur als eine Erneuerung der Sprache der plastischen Künste. Die wichtigste Eroberung des schöpferischen Geistes Picassos, die man als Folge dieser Revolution betrachten kann und die zum Grundstein des ganzen folgenden Schaffens wurde, liegt in der Poetik der Metapher, d. h. im Aufbau eines Bildes auf noch so kühnen Assoziationen, auf dem Spiel und der Kraft der Einbildung. Die Entwicklung dieser neuen Poetik bringt bereits in der Epoche des reifen Kubismus solche unerwarteten Erfindungen hervor wie die Einschließung von Wörtern anstelle von wörtlich gemeinten Bildern in den visuellen Kontext. Gerade dann wird Picasso, wie er später sagte, mit Worten malen. Und vielleicht als erster Schritt in diese Richtung ist sein Requiem an Alfred Jarry, Stillleben mit Schädel, zu verstehen.
Das Erscheinen dieses Programmgemäldes am Vorabend des Jahres 1908 — des Stilllebens zum Thema des Todes — offenbart den Drang Picassos nach der langen Periode einer „Umwertung der Werte“, sein neues schöpferisches Bewusstsein in konzeptuellen Werken auszudrücken. Aber obwohl Picasso vom Anfang des Jahres 1908 an in seinen Skizzenbüchern eine Vielzahl von verschiedenen Sujets entwirft und entwickelt, die zu bedeutenden Kompositionen hätten führen können, bleibt fast jedes dieser Projekte im Stadium der Vorbereitungsarbeit. Und was zu Ende gebracht wurde, wurde anders ausgeführt, als es erdacht war.
Trotz der Aufmerksamkeit, die in den letzten Jahrzehnten dem sogenannten frühkubistischen Schaffen Picassos gewidmet wird, und der bedeutenden Bemühungen, die Vorstellungen über seine Evolution zu ordnen, ist im Verstehen der Periode der Jahre 1907-1908 noch keine wirkliche Klarheit erreicht.[63] In der Chronologie herrscht ein Durcheinander, das die Verworrenheit der Begriffe über die schöpferischen Ideen des Malers, über ihre Wechselbeziehungen und Fortschritte widerspiegelt. Die Frage der bildlichen Vorstellungen Picassos dieser Zeit ist fast gar nicht berührt, und bis heute nicht im notwendigen Maße begriffen worden. Die Angewohnheit des formalen Herangehens und des vorgefassten Standpunktes zum Schaffen dieser Zeit als der Zeit des Protokubismus oder Vorkubismus (als eine Voretappe im Werden des eigentlichen Kubismus) nimmt den Kunstwissenschaftlern die Möglichkeit, diesen Zeitraum in seiner ganzen Bedeutung einzuschätzen. Unterdessen hörte der Besucher der Werkstatt Picassos gerade im Jahr 1908, während der Kulmination des Protokubismus, von ihm keine Äußerungen über „Volumen und Massen“, sondern „über subjektive, emotionelle und instinktive Erlebnisse“.[64]
Sieht man vom Begriff des Protokubismus ab und nimmt die künstlerischen Mittel des Jahres 1908 in ihrer Gesamtheit, ohne Rücksicht auf Dimensionen oder Technik der Ausführung, sei es Malerei, Skulptur oder eine kleine Skizze, so wird die organische Einheit der Umrisse als eine Art von monumentalem Ensemble sichtbar, und zwar nicht nur in Bezug auf die Werke, sondern auch auf die schöpferischen Ideen Picassos. Unwillkürlich entsteht das Bild eines grandiosen Projekts, das nicht verwirklicht worden ist, ähnlich Michelangelos Grabmal des Papstes Julius; einzelne, oft unvollendete Skulpturen-Fragmente des erdachten Werkes leben schon lange ihr eigenes Museumsleben, außerhalb der vom Autor bestimmten Rollen, in sich rätselhafte Dinge, eigenständige Bruchstücke eines nicht existierenden Ganzen. Genau so sind die Werke Picassos des Jahres 1908, die auf den ersten Blick durch ihre Bedeutsamkeit, die Kraft ihres Ausdrucks überraschen; doch muss man den Ideenkontext dieser Kunst wiederherstellen, damit die einzelnen Werke den ihnen eigenen Sinn erhalten. Wie Goethe konnte auch Picasso sagen (und er sagte es auch, aber mit anderen Worten): „Alle meine Werke sind nur Auszüge einer großen Beichte; um sie zu verstehen, muss man ihre Entstehung kennen, den Augenblick ihrer Empfängnis begreifen.“[65]
Indem man zu den Ausgangsideen zurückkehrt — den Skizzen, Entwürfen, Umrissen —, sieht man überall nicht nur einfach figürliche Kompositionen, sondern gleichsam Darstellungen von bestimmten Ereignissen, Entwürfe für geplante Sujetvorhaben, jedes mit einer eigenen inneren Dramaturgie. Es hat den Anschein, als bringe die neue Form selbst, die auf ausdrucksvollen Rhythmen starker, gespannter Linien, scharf und klar artikulierter Ebenen, auf dem inneren Gleichgewicht der malerischen Struktur des Ganzen aufgebaut ist, diese so morphologisch klare und eindrucksvoll monumentale Form in der Phantasie des Malers hervor, unpersönliche, zeitlose Bilder, voll ursprünglicher Kraft. Was in den Arbeiten des Jahres 1907 unklar als der Vorzeit nachempfunden begriffen wurde, als ein gewisser Hintergrund der Ewigkeit, wird jetzt dank der Eigenschaften der Form objektiviert und geht in der Sujetlösung auf.
Aber das schöpferische Denken Picassos hatte sich schon seit langem über psychologische Schranken hinaus in ein Gebiet der Vorstellung gewagt, in dem keine Geschichten fabuliert werden, poetische Novellen mit narrativ-psychologischen Verbindungen, sondern wo im Bewusstsein jene Urbilder auftauchen, die der Universalität des Mythos eigen sind.
Im Laufe des Jahres 1907, vertieft in die Entwicklung der neuen plastischen Anatomie seiner Malerei und ausgehend von den Grundzügen der menschlichen Gestalt, entdeckt und erkennt Picasso nach und nach instinktiv die körperlich-psychologischen Unterschiede der Archetypen männlicher und weiblicher Gestalt: die Quadratur, Symmetrie und Statik der einen und den rautenförmigen Charakter (die Fähigkeit zu plastischen Deformationen, Duldsamkeit und Gotik) der anderen. In den Wurzeln des morphologischen Baus spürt er die metaphorisch ausgedrückte wesentliche Wahrheit der Welterscheinungen auf.
Zu dieser Zeit bereits entdeckte Picasso für sich in der ethnographischen Abteilung des Palastes Trocadero in Paris die afronegroide Schnitzskulptur und besaß, wie auch mehrere andere Maler, einige Statuetten und Masken. Für ihn waren das nicht nur Werke von außergewöhnlicher Ausdruckskraft, in deren Nachahmung man den Sinn ihrer Wiederentdeckung suchte. A. Malraux gibt die Worte Picassos wieder: „Ihre Formen wirkten auf mich nicht mehr als auf Matisse. Oder auf Derain. Doch für sie waren diese Masken Skulpturen wie andere auch. Als Matisse mir den ersten negroiden Kopf zeigte, sprach er von ägyptischer Kunst.“[66] Picasso aber erblickte in ihnen sofort magische Dinge, die voll von bildhaftem Sinn waren. Die Entdeckung der negroiden Kunst überraschte ihn, weil sie seinem eigenen Erleben und seinem eigenen Verhältnis zum Schaffen entsprach. So wie ihn ein Jahr zuvor das Bedürfnis der inneren Selbsterkenntnis zur vorklassischen iberischen Skulptur geführt hatte, so erkennt er jetzt dank der irrationalen, abergläubischen Seite seiner komplizierten Natur in den magischen Figuren von Geistern die universellen Ziele der Kunst.
Ab Herbst 1907 befasst er sich viel mit der Skulptur, indem er aus Holz seltsame Fetischfiguren schnitzt, primitive Puppen, Entwürfe für künftige Skulpturen zeichnet (siehe Studien und Radierungen). In der Leidenschaft zum Holzschnitzen blieb er nicht allein, in derselben Zeit ging auch Derain dieser Beschäftigung nach. Aber im Unterschied zu Derains Arbeiten fehlte in dem, was Picasso machte, jede Anspielung auf das Dekorative. Das sind wirklich Fetischfiguren, von denen Ernst, etwas Bedrohliches, Dramatisches ausgeht. Genau solche Figuren werden ungefähr ab Anfang 1908 zu Gestalten seiner Bilder.
So das Gemälde Freundschaft, dessen figürliche Motive für die in mehreren Skizzen und einigen Fassungen entworfene Komposition zum Thema des Badens im Waldsee bestimmt waren. In den Moskauer Gouacheskizzen zum Ermitage-Gemälde sind die wichtigsten bildlichen Charakteristiken der Gestalten angedeutet: Die weibliche Figur mit der über den Arm geworfenen Drapierung ist in hellen Ockertönen gehalten; sich auf ihre Schulter stützend, tritt hinter ihr eine bräunliche männliche Gestalt hervor. Picasso malt sie als einen einheitlichen Block, als ob er sie aus einem Holzstück herausschlägt. Er gestaltet die menschliche Anatomie wie eine plastische Konstruktion, indem er das Gemälde als Skulptur auffasst. „Man braucht die Bilder, sagte mir Picasso“, so erinnerte sich der Bildhauer Julio Gonzales gerade an diese Arbeiten des Jahres 1908, „nur zu zerschneiden (die Farben sind ja nicht mehr als Hinweis auf die Perspektiven der dorthin oder hierher geneigten Ebenen) und danach wieder zusammenzufügen – gemäß den Anweisungen der Farbe – damit eine Skulptur zustande kommt. Die verschwundene Malerei wird sich nicht verlieren.“[67]
In der vollendeten Freundschaft gab Picasso den Körpern mehr an Dichte, unterstrich bestimmter die Wechselbeziehungen der Formen und Ebenen, dämpfte die Töne, indem er dem Kolorit Härte verlieh und damit den Effekt der mächtigen Einheit, des gemeinsamen Schreitens der Figuren verstärkte.
Indem er das Gemälde als eine Skulptur betrachtete, näherte Picasso sich seinem Sujet auch als Bildhauer: Wenn die Malerei immer eine Illusion, eine Projektion auf die Leinwand ist, so verkörpert die Skulptur stets das Wesen der gegenständlichen Wirklichkeit; das Bild der Skulptur liegt im Charakter dieses Gegenstandswesens. Die Freundschaft ist ein konventioneller Titel, aber wir sehen die Gesten des Stützens und der zarten, wohlwollenden Berührung und empfinden eine vollkommene Harmonie der Rhythmen und den schlafwandlerischen Zustand der Gestalten. Diese Momente bringen in das unpersönliche Bild des Gemäldes eine Note des Psychologismus, fast der Genrehaftigkeit ein. Sie sind unzureichend für ein Sujet, aber sie genügen, um den Gang der Assoziationen anzudeuten, die zu den bildlichen Vorstellungen dieser protokubistischen Periode Picassos führen.
Einfacher gesagt, man kann den Grund und den Sinn des Protokubismus Picassos als das Streben betrachten, das malerische Sehen der objektiven Welt radikal zu vereinfachen, indem er es von der Aufschichtung des Illusorischen befreit und so das konstruktive physische Wesen freilegt. Hier beruft man sich auf die berühmten Worte Cézannes in dem gerade im Herbst 1907 veröffentlichten Brief des Malers an Emile Bernard: „Gestaltet die Natur mittels des Zylinders, der Kugel, des Kegels.“ Als einen anderen Ausgangspunkt des sogenannten Protokubismus erkennt man den negroiden Einfluss, der das Gröberwerden der Anatomie und andere Züge der Expressivität mit sich brachte. Indem man diese beiden diametral entgegengesetzten Einflüsse zusammennimmt — den der wahrnehmenden Kunst Cézannes und den der konzeptuellen Kunst des schwarzen Afrikas —, erklärt man sich gewöhnlich das stilistische Phänomen des Protokubismus als das einer Kunst, die voll und ganz mit den Problemen des Raumes beschäftigt ist.
Aber wenn man sich in die Quellen der schöpferischen Ideen Picassos vertieft — in seine Skizzenbücher des Anfangs 1908 — sieht man nicht eine objektive Realität, die einer Geometrisierung um der Geometrisierung willen unterzogen wird, sondern das Streben des Malers, mit dem Ausdruck seiner subjektiven Wahrheit der Ursprünglichkeit und der Wesenstiefe der menschlichen Natur vollständig zu entsprechen. Über dasselbe und zur gleichen Zeit schrieb Apollinaire, das „zweite Ich“ Picassos: „Aber ich hatte die Erkenntnis der verschiedenen Ewigkeiten von Mann und Frau“ — und viermal wird das beharrlich wiederholt in dem kleinen, dunklen, rätselhaften Poem in Prosa und Versen Onirocritique, das im Januar 1908 veröffentlicht wurde.
Mit dieser Suche nach den „verschiedenen Ewigkeiten von Mann und Frau“ beginnt der Protokubismus Picassos im Jahre 1908. Damals erschienen in seinen Alben Entwürfe zu zwei Gemälden: Sitzender Mann und Sitzende Frau, die paarweise gedacht waren. Der Mann ist monolithisch-kubistisch wie die Statuen der Azteken mit ihrer akzentuierten Frontalität und der Symmetrie ihrer Gestalten: Beide Arme liegen eng am Rumpf, der Kopf ist nach vorn geneigt, die Augen sind geschlossen, die ganze Figur drückt Verdrossenheit und primitive Kraft aus. Die Frau ist plastisch komplizierter: In ihrer Hieroglyphe sind Asymmetrie, Windungen, d. h. der Aspekt des Leidens unterstrichen. Bemerkenswert ist, dass Picasso die unterschiedlichen Ewigkeiten von Mann und Frau später als Hieroglyphen auf einer Keramikkachel darstellte. Die Skizzen des sitzenden Mannes wurden erst Ende des Jahres 1908 in dem Ölgemälde Sitzender Mann realisiert. Die Sitzende Frau wurde sofort auf einer anderthalb Meter großen Leinwand gemalt.
Es ist kaum anzunehmen, dass Picasso in diesem Bild „das Problem des Raumes löste, indem er zur brutalen Geometrisierung griff, die der dargestellten Frau das Aussehen einer mechanischen Statue verleiht“ (Daix).[68] Im Gegenteil ist alles in der Sitzenden Frau der Expressivität untergeordnet: Nicht nur die kummervolle Pose der Figur, sondern auch die Vergröberung der Formen und die Schärfe der graphischen Schrift selbst, das bedrückende braune Kolorit und die Dramatik des tonalen Kontrastes, sogar die „narbige“ Oberfläche des Pinselstriches — das ist die Metaphernsumme des Leidens als des ewigen weiblichen Wesens. Gestalterische Bedeutung haben hier die körperlichen und mimischen Deformationen: In diesen Entstellungen lässt sich der Versuch ahnen, eine der Ewigkeiten der Frau als „machine à souffrir“ (Leidmaschine) auszudrücken, nach der eigenen Formulierung Picassos dreißig Jahre später, zu der Zeit von den Weinenden Frauen und Guernica.
Eine Antithese zu dem Sitzenden Mann — und eine andere plastische Ewigkeit der Frau, diesmal ohne die Seelenqual — stellt die aus demselben Skizzenbuch stammende Frau mit dem Fächer dar. In diesem Bild herrscht das harmonische Prinzip innerer Ausgeglichenheit vor: wechselseitige Widerspiegelung und ein Dialog zwischen Formen und Rhythmen, eine ruhige Abstufung der ockerfarbenen, weißen und grauen Töne. Dieses als Porträt Fernande Oliviers gedachte Gemälde bewahrte in seinem formalen Aufbau die der Natur und dem physischen Typ des Modells eigene Ruhe, eine klassische Klarheit und erhabene Gelassenheit. Und wenn die Gestalt des Bildes durch ihre Kompaktheit und Geschlossenheit an ägyptische sitzende Statuen erinnert, so lässt sich hier, zwar noch nicht buchstäblich, aber aus ihren monumentalen Proportionen, schon die gigantische Ordnung des sogenannten klassischen Stils Picassos der 1920er Jahre vorausahnen.
Die dritte Fassung des Motivs der sitzenden Frau, die aus demselben Skizzenalbum des Frühjahrs 1908 stammt, führte einige Monate später zu dem Gemälde Weiblicher Akt in der Landschaft, in dem noch eine weitere weibliche Ewigkeit behandelt wird — die dunkle, ursprüngliche Naturkraft des Geschlechts. Die Pose der nackten Frau, die willenlos vom Sessel gleitet, wie sie in der Skizze vorgegeben ist, wird im Gemälde in eine bedrohende Bewegung verwandelt, die voll sexueller Aggression ist. Wie aus einer Nische hervortretend, aus der Tiefe des Waldes, wird diese Figur vom Betrachter als die Verkörperung der dichten, mächtigen, blinden Natur empfunden, die in sich nicht nur schöpferische Lebenskraft trägt, sondern auch die irrationale Energie der Zerstörung. Dieser oft Dryade genannte Akt ist archaischer als die Waldhalbgötter der griechischen Klassik; er ist den großen Göttinnen der uralten Mythologien der Menschheit verwandt.
Picasso gestaltet gleichsam nicht eine Frau, sondern eine bestimmte prähistorische weibliche Statue mit all ihren Vergröberungen und barbarisch expressiven Entstellungen. Gleichzeitig, scheint es, strebte er in seiner malerischen Lösung zu demselben dramatischen Effekt der scharf aufgehellten Nacktheit, durch den der harte und pathetische Tenebrismus der religiösen Malerei des 17. Jahrhunderts überrascht.
Wahrscheinlich hinterließen diese Gemälde nicht von ungefähr bei manchen russischen Betrachtern den Eindruck einer Kultkunst (hier unwichtig, ob nun einer „dämonischen“ oder „barbarischen“), wie auch nicht zufällig ist, dass Pierre Daix, der den Kubismus auch von den formalen Positionen her untersuchte, sich des öfteren auf die Werke von Claude Levy-Strauß bezieht, die dem Studium der Mythen gewidmet sind.[69] Ganz gewiss erreicht hier der Protokubismus Picassos, der nicht vom Äußeren der Erscheinungen und Dinge ausgeht, sondern von den angespannten emotionalen und instinktiven inneren Erlebnissen (wie es der Maler selbst erklärte), von dem Eindringen in immer tiefere Schichten des psychischen Lebens, hellseherisch (wie Rimbaud hätte sagen können) in das Überpersönliche und damit an das archaische Mythenbewusstsein grenzt.
Freundschaft, Entwurf, 1908. Aquarell, Tinte auf Papier, 61,9 x 47,6 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.
Nackte im Wald (Dryade oder Landschaft mit einer Nackten), 1908. Öl auf Leinwand, 185 x 108 cm. Ermitage, St. Petersburg.
Formal gesprochen kann der Weibliche Akt in der Landschaft als eine Interpretation der für die Malerei des 19. Jahrhunderts traditionellen Figur der Badenden vor einem Landschaftshintergrund verstanden werden. Aber Picasso dringt tiefer in das Wesen der Dinge ein und entdeckt hinter der bukolischen Oberfläche des Motivs die mythologischen Bindungen der Frau mit der Pflanzenwelt, der unbewussten Energie des Schlafs und dem ganzen Bereich des Irrationalen, das zugleich bewegungslos und bedrohlich ist.
Zum Schlüsselwerk, das sowohl die formale als auch die bildhafte Problematik des Protokubismus Picassos in sich vereint, wurde das bedeutende Gemälde des Jahres 1908 Drei Frauen. Zu ihm gelangte der Maler ebenfalls über das Thema der Badenden, das er ungefähr seit Ende 1907 zu entwickeln begann, wahrscheinlich nicht ohne den Einfluss der epischen Badenden Cézannes. Er nahm sich damals eine Komposition zum Thema des Badens im Walde vor, einer Theaterszene ähnlich: Links hinter den gleichsam eine Kulisse bildenden Bäumen erscheinen zwei Figuren aus der Freundschaft, die sich dem Ufer eines Waldsees oder eines Flusses nähern und der als eine kompakte Gruppe drei nackte Badende in einem Boot vorgelagert sind.
Einige Bruchstücke der „Erzählung“, die sowohl im Figurenmotiv der Freundschaft zu spüren sind, als auch in der Bootszene am Waldsee und in dem allgemeinen Szenenplan, sind wiederum nur ein Sprungbrett für die Phantasie, die nicht in eine Geschichte, sondern in die anonyme und zeitlose Distanz des Mythos führt. Aber nachdem es einige vorangegangene Etappen im Skizzenstadium durchlaufen hatte, verlor das Vorhaben Picassos seine narrativen Momente und mit ihnen das friesartige Entwickeln der Komposition. In den Drei Frauen sind von dem ursprünglichen Plan zum Baden im Walde nur der allgemeine Aufbau der rechten Dreifigurengruppe und die farbige Konzeption geblieben: die roten Töne der Körper, die vibrierenden smaragdenen Töne des Waldgrüns ringsum und die silbriggraue Farbe des Wassers, die auf die fließende Drapierung der linken Figur übertragen wurde. Und die drei riesigen Akte selbst erinnern, kaum von dem mütterlichen Felsen abgetrennt, und aus etwas Festerem als Fleisch gemacht, ihrem Geist und Bau nach eher an Sklavenfiguren Michelangelos, die sich mühevoll aus dem steinernen Chaos herausschälen, und weniger an sich der Natur hingebende Badende.
Ihr Sein bewegt sich an der Grenze des Schlafs, ihre somnambulen Posen beschwören unbewusste und instinktive Kräfte, von denen sie beherrscht werden; sie sind in ihr Sein hineingezwungen, einer verborgenen Absicht gehorchend. Betrachten wir diese Figuren aufmerksam, können wir trotz ihrer scheinbaren Gleichförmigkeit die Unterschiede bemerken, die subtil, aber bestimmt jede Gestalt von den anderen absetzen. Diese Unterschiede sind nicht nur die Folge davon, dass jede der Gestalten zu einer anderen Zeit gemalt wurde, sondern auch ein Zeichen dafür, dass jede der drei Figuren eigentlich ein einzelnes Bild ist; aus ihren Wechselbeziehungen erwächst die kompositorische und sinnliche Einheit des Ganzen, wird die innere Dramatik dieser seltsamen, in Erstarrung versunkenen Szene aufgebaut. Aber was sind das für Unterschiede?
Die rechte Figur ist ausgeprägt weiblicher Natur; ihr wird die linke gegenübergestellt, die ausgeprägt männlicher Natur ist. Leo Steinberg, indem er die Aufmerksamkeit darauf lenkt, bemerkt, dass es treffender wäre, das Bild Zwei oder drei Frauen zu nennen.[70] Aus seiner weiteren Interpretation folgt jedoch, dass auch die mittlere Figur keine Frau darstellt, vielmehr ist sie eine Personifizierung des „vorbewussten hominis, des heimlichen Mutterleibes, von dem das menschliche Geschlecht ausgeht, sich in ein Er und eine Sie trennend“. Dieser amerikanische Autor behandelt also den Inhalt des Gemäldes im Sinne einer Freudschen Verschlüsselung als einen Mythos der Schöpfung, ein Psychogramm der Gestaltung des menschlichen Lebens, als dessen Dominante die Trennung der Geschlechter betrachtet wird. Aber gerade die Eindeutigkeit und das Rationalistische solch einer Interpretation ruft im Falle der vieldeutigen Bilder Picassos, die (nach einem Ausdruck Goethes) nicht durch die Vernunft geteilt werden können, ohne dass ein Rest übrigbliebe, Zweifel hervor. Hier ist es nützlicher, sich mehr an das Objekt zu halten.
Nachdem Picasso auf das Vorhaben des fünffigurigen Badens im Walde verzichtet hatte, verzichtete er auch auf jedes Thema, das einen Konflikt enthalten könnte, sei er auch noch so gering; er verzichtet auf das Drama, ein Element, das für ihn immer noch wichtig war. Er begann das dreifigürige Motiv der Drei Frauen zu entwickeln, und als Zwischenetappe entstand dabei eine rhythmisierte Version des Motivs (wie Daix es nannte) mit dem mächtigen dynamischen Bild eines spiralförmigen zentrifugalen Wirbels, der fast die Grenzen der Abstraktion erreichte. Aber auch in diesem stark stilisierten Bild findet sich, wie es scheint, das eigene Sujet, das eigene Drama wieder.
Man kann das spüren, wenn man einige Verbindungen wiederherstellt. Seit dem Beginn des Jahres 1908 revolutioniert Guillaume Apollinaire, wie schon erwähnt, sein schöpferisches Bewusstsein. Ihn begeistert die Erfahrung der Malerei, d. h. die Erfahrung Picassos, seine zahlreichen Gedichte und ästhetischen Überlegungen des Frühjahrs 1908 legen davon Zeugnis ab.[71] Damals entsteht in seiner Phantasie zum ersten Mal das grandiose Bild, das mit der Zeit das zentrale in seiner Poetik und zum Schlüssel für sein erneuertes schöpferisches Bewusstsein wurde.
Das ist Die mächtige Flamme mit ihrem ganzen Spektrum von Bedeutungen und Metaphern: vom Licht der Augensterne des Freundes, d. h. Picassos, an den der Dichter grenzenlos glaubt und vom Feuer des Willens und des Glaubens, das alles Überholte verbrennt und aber den poetischen Phönix zum neuen Leben erweckt, bis hin zur aufleuchtenden Vernunft, deren strahlende schöpferische Macht der göttlichen Lebenskraft der Sonne, der rothaarigen Schönheit des Dichters, gleicht.
Erstes Leben hat dieses Bild in dem im Frühjahr 1908 geschriebenen Artikel über die Prinzipien der Malerei Drei plastische Werte erhalten, der durch die neuen Bestrebungen Picassos angeregt wurde. Apollinaire postulierte darin: „Die Flamme ist das Symbol der Malerei, und die drei plastischen Werte leuchten strahlend“, um anschließend jeden dieser drei Werte für sich zu betrachten: die Reinheit, die Einheit, die Wahrheit. „Die Flamme verfügt über eine Reinheit, die nichts Fremdes duldet und unerbittlich alles in sich aufnimmt, was sie erreichen kann. Sie verfügt über eine magische Einheit, so dass, wenn man die Flamme teilt, jeder Funke zu einer selbständigen einheitlichen Flamme wird. Sie verfügt schließlich über die erhabene Wahrheit ihres Lichtes, die niemand verneinen kann.“[72] Im Verlauf des Artikels entwickelt der Autor diese Metapher in einer ihm eigenen allegorischen, pythischen Sprache weiter, die sich jedoch entschlüsseln lässt. Doch hier ist etwas anderes wichtig — der erstaunliche geschichtliche und typologische Parallelismus des Apollinaireschen Bildes der riesigen Flamme als der Metapher der Malerei („einer erstaunlichen Kunst, deren Licht grenzenlos ist“) und der rhythmisierten Version des flammenden Wirbels, der drei weibliche Körper unerbittlich in sich hineinzieht, der über die magische Einheit des Stils verfügt und der schließlich die höchste Überzeugungskraft eines Kunstwerkes besitzt. In diesem Sinne richtet sich die Aufmerksamkeit auf die in den Studien ständig wiederkehrende terrakottarote Farbe der Figuren, die bisweilen buchstäblich eine flammende Intensität erreicht, auf die Dreieinigkeit der ungestüm nach oben strebenden zeigerhaften Formen, auf die quälende Sehnsucht in den Posen dieser Figuren, die in ihrer Gruppierung, wie auch im Artikel Apollinaires, gleichzeitig an ein dreizüngiges Lagerfeuer und eine heraldische Lilie — das Symbol der Reinheit — erinnern.
Picasso kannte mit Sicherheit diesen Artikel und die Gedichte des Dichterfreundes. Und Apollinaire sah bestimmt im Atelier „Bateau-Lavoir“ die riesige Leinwand mit den drei glühenden kolossalen Akten, als würden sie von dem Rätsel ihres Daseins gepeinigt. Im Lauf des Jahres 1908, dank der erneuten Annäherung Picassos und Apollinaires, spiegelte sich jeder von ihnen im Schaffen des anderen wider. Wieder, wie in der Zirkusperiode, berühren sich die Themen ihrer Werke, sind ihre Methoden einander nah — alles aus dem eigenen Inneren zu zeichnen, das Bild auf den Schichten der subjektiven Assoziationen, auf dem Spiel der Metaphern aufzubauen, ohne wegen des esoterischen Ausdrucks in Verlegenheit zu geraten.
Und als am Übergang von den rhythmisierten Studien der Drei Frauen zur monumentalen Leinwand wieder die smaragdenen Töne der Skizzen des Badens im Walde entstehen, als die verschiedenen Körpertypen dieser glühenden Figuren skizziert werden und ihre barbarische, ursprüngliche Bildhaftigkeit konkretisiert wird, entstehen wiederum Parallelen zum Schaffen Apollinaires des Jahres 1908, mit seinem damals vor der Veröffentlichung stehenden Buch Der verfaulende Zauberer. In diesem Buch gibt es ebenfalls das Motiv des dichten und dunklen Waldes mit seinen Geschehnissen, die sich, ähnlich schlafwandlerischen Geheimnissen, um eine Hauptidee — das Bewusstsein der verschiedenen Ewigkeiten des Mannes und der Frau. Und auch das Werk selbst ist in die Form eines bestimmten Mythos gekleidet, „dessen Wurzeln, nach den Worten seines Autors, sich weit verzweigen, bis zu den keltischen Tiefen unserer Tradition“.[73]
Das Gemälde Drei Frauen gehört zu den Kompositionen, die zu kompliziert sind für eine sprachliche Interpretation: Der Kern des Bildes ist ein Geheimnis, von dem eine Spannung ausgeht, die sich an unsere emotionelle und intellektuelle Aktivität wendet. Unter den Blättern der späteren Serie 347 Gravüren, als Picasso sich dem Strom seines Bewusstseins überließ und der freien bildhaften Assoziation, gibt es ein Blatt (Nr. 38 vom 14. 4. 1968), in dem, so scheint es, der ferne Widerhall des Jahres 1908 zu hören ist. In der Dämmerung des Ateliers sitzt vor einem riesigen Gemälde ein alter Maler; genau betrachtet er seine Schöpfung; dort, von ihm unabhängig, leben in ihrer autonomen Realität drei gigantische Akte; einer von ihnen, mit kubistischen Merkmalen in Zeichnung und Gestalt, die Ellenbogen emporgehoben, blickt auf den alten Maler, der im Verhältnis zu ihnen klein und gespenstisch wirkt… Das Gemälde Drei Frauen wurde, nach Meinung der Wissenschaftler, mit Unterbrechungen im Laufe mehrerer Monate des Jahres 1908[74] gemalt, und das Schaffen Picassos verlief in jener Zeit gleichsam vor dem Hintergrund dieses Gemäldes, das im Atelier dominierte, indem es die Ergebnisse vieler paralleler Arbeiten, malerischer und Skulpturarbeiten, in sich aufnahm.
Drei Frauen, Entwurf, 1908. Aquarell, Tinte auf Papier, 54 x 47,7 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.
So ist das Interesse für die Darstellung von Volumen auf der Fläche im Jahre 1908 bei Picasso untrennbar von der Begeisterung für die Skulptur, und erst im Jahre 1909 kam der Maler auf dieser Grundlage in Berührung mit der rein malerischen Erfahrung Cézannes, indem er von der Färbung der dort- oder hierhin geneigten Flächen zum Modellieren der Volumina mittels feiner Pinselstriche, farbigen Passagen, die die Form modellieren, überging. Die Form der Drei Frauen ist vom Bildhauer geschaffen, denn dieses Gemälde kann man sich tatsächlich nach den Linien des Schnitts zerlegt und wieder zusammengestellt auch als eine Art Skulptur vorstellen.
Was Die Bäuerin in Lebensgröße betrifft, mit ihrer mächtig gebauten Körperlichkeit und ihrer gewaltigen, mit Energie wie mit Dynamit geladenen Masse, so entstand das Gemälde direkt aus dem Entwurf einer geschnitzten Statue, wie es die Studienblätter ihrer Ansichten in drei Dimensionen zeigen. Das wahre Temperament des Plastikers, das bei Picasso von dem Bildhauer Julio Gonzales erkannt wurde, veranlasst ihn, lapidar zu sein, die zufälligen Züge um der Offenbarung des plastischen Wesens des Bildes willen zu eliminieren und seine wahre Realität zu enthüllen. Ein solches Herangehen nannte Picasso Surrealität, denn er betrachtete sich sogar in den Jahren des Kubismus als realistischen Maler. Die Skulptur ist aber auch eine Überprüfung des Realitätsgefühls im Sinne der körperlichen Überzeugungskraft, da für Picasso „die Skulptur die beste Erläuterung ist, die ein Maler zur Malerei geben kann“.[75]
Die Bäuerin, Brustbild ist das malerische Porträt einer Statue, ein und derselben Person, der Wirtin des Dorfgasthauses in La Rue-des-Bois bei Paris, wo der Maler am Ende des Sommers 1908 einige Wochen verbrachte. Ihr Name ist bekannt, vielleicht existiert auch irgendwo ihr Foto, aber sie werden uns kaum mehr von der Realität der Madame Pütman überzeugen, als Die Bäuerin Picassos mit ihrem einfachen, wahrscheinlich ganz gewöhnlichen Gesicht, mit ihrem bäuerlichen Körperbau, der von der schweren Arbeit auf dem Acker gezeichnet ist. Die gleichen unbeholfenen Typen aus dem einfachen Volk zeichnete mit eindringlichem Realismus bereits der junge van Gogh, aber in dem karg und treffend gebauten Monolithen der Bäuerin Picassos ist zugleich jener Überrealismus lebendig, dem Die Bäuerin das Aussehen einer gewissen großen chthonischen Göttin verdankt, die, von einer unüberwindlichen Schwerkraft gefesselt, ihren abwesenden Blick zum Himmel erhebt.
„Eine Flasche auf dem Tisch ist genauso bedeutend wie ein religiöses Bild“ — genauer kann man sich nicht über das Wesen der Stillleben Picassos des Jahres 1908 äußern, als er das selbst im Gespräch mit Jakob Tugendhold zu Beginn des ersten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts getan hat.[76] Und wenn heute die Forscher in solchen Werken wie Grüne Schüssel und schwarze Flasche und Blechkanne und Schüsseln nicht nur eine Rückkehr zur Konkretheit, sondern auch eine Dramatisierung des umgebenden Raumes (Daix) bemerken, so wurden im Russland der Jahre nach 1910 dieselben Stillleben aus der Stschukinschen Sammlung fast wie gewisse geistliche Offenbarungen, als eine Art „schwarzer Ikonen“ empfunden. Nicht aus irgendwelchen symbolischen oder mysteriösen Gegenständen, sondern aus den trivialen Dingen des Hausgebrauchs zusammengestellt, scheinen diese Darstellungen jedoch weniger vom Interesse für ihre objektive Dinghaftigkeit als vom Bedürfnis der Selbstäußerung des Malers diktiert, auf jeden Fall die ersten dieser Art. Wahrscheinlich wurden sie auch nicht nach der Natur gezeichnet, wie alle Kompositionen, Figuren, Landschaften, die von Picasso im Jahre 1908 in seinem Atelier angefertigt wurden.
Das Stillleben Grüne Schüssel und schwarze Flasche erschüttert mit seinem erstaunlichen malerischen Hintergrundeffekt, der um vierzig Jahre verfrüht den abstrakten Expressionismus mit seiner „Trauer der letzten Tage“, die von den postsymbolistischen Rezensenten Picassos in Russland krass empfunden wurde, vorwegnahm und vielleicht ausschöpfte, eine dramatische Exaltation des Ausdrucks, die man eigentlich von Szenen des Leidens und des Märtyrertums erwartet. Eine Dramatik von derart außergewöhnlicher Wucht musste von außerordentlichen psychischen Umständen begleitet sein. Aus den Erinnerungen der Fernande Olivier ist der schreckliche Eindruck bekannt, den am 1. Juni 1908 der Selbstmord seines Nachbarn in „Bateau-Lavoir“, des deutschen Malers Wiegel, auf Picasso machte. Stilistisch zu den Sommerarbeiten dieses Jahres gehörend, spiegelt das Bild Grüne Schüssel und schwarze Flasche durch seine Trauerakkorde von schwarz-rotem Kolorit wahrscheinlich die noch nicht von der Zeit besänftigten Erlebnisse Picassos wider. Aber schon in solch einem Gemälde, wie Blechkanne und Schüsseln, das bald darauf gemalt wurde, dominiert wieder die Willenskonzentriertheit des Gedankens über die Dramatik der Erlebnisse. Sie ist vorhanden in der unbedingten Logik des plastischen und nichtillusorisch-perspektivischen Aufbaus des Raumes, in der monumentalen Gruppierung der Skulpturformen, die in einer emporsteigenden Spirale um einen einheitlichen Kern konzentriert werden, im dem durchgehenden Gleichklang der Bögen und Ovale, in dem gespannten, aber unwandelbaren Gleichgewicht der ganzen tektonischen Struktur, der Gestalt des Gemäldes im Ganzen, und schließlich sogar in der zurückhaltenden Energie des Pinselstriches, in dem Streben nach einer alles umfassenden Vollendung der Ausführung.
Gegen Ende des Sommers 1908 finden Picassos Visionen trotz seiner Aversion gegen die Waldnatur der Ile-de-France, wo es für einen Spanier unerträglich nach Champignons riecht und die „Nymphen Vater Corots“ allgegenwärtig scheinen, in der beruhigenden Umgebung des Dörfchens La Rue-des-Bois das Gleichgewicht wieder und erlangen fast naive Einfachheit. In der dort gemalten Landschaft Häuschen und Bäume „ist das Haus ohne Zweifel ein Haus und der Baum ein Baum“.[77] Ähnlich wie ein Basrelief-Künstler schafft Picasso sich den Raum seiner Landschaft durch die Trennungslinien breiter, gegeneinander geneigter Flächen, indem er die dreidimensionale Tiefe durch die unterschiedliche Höhe der, erhaben wie Obeliske, in maßvollem Rhythmus zurücktretenden Bäume bezeichnet. Aber dank des ruhigen, ausgeglichenen Aufbaus der Komposition und einer zurückhaltenden Palette von natürlichen Farben entsteht, anders als zuvor, der Eindruck eines objektiveren Blickes auf eine Welt, in der es einen Weg und ein Haus hinter dem Zaun, ein aufgepflügtes Feld hinter dem Baum rechts und in der Ferne eine Anhöhe unter dem trüben Himmel gibt.
Genauso objektiv und einfach ist das wahrscheinlich ebenfalls dort entstandene Stillleben Topf, Weinglas und Buch. Auch in diesem Bild herrscht die Stimmung der klaren Betrachtung sowohl eines gegenständlichen Motivs als auch der auf der Leinwand entstehenden formalen Beziehungen vor. Das Auge registriert nüchtern, aber ohne Zwang die gegebenen Formen, Linien und Flächen, den unkomplizierten Kompositionsknoten der drei Gegenstände und drei Ebenen. In dem von ihnen gebildeten Raum existiert etwas von der irrealen Bedingtheit byzantinischer Ikonen und den schweigsam-asketischen Stillleben Zurbaráns. Aber im Stillleben Picassos, das dem Symbolismus und auch der Metaphysik fremd ist, trägt die prismengleiche Brechung des im Weinglas reflektierten Topfrandes den Akzent des Seltsamen in die Welt des Alltäglichen und des Unbelebten, die sich unter dem zum Staunen fähigen Blick des Malers, der seine neue formale Syntax aus der Realität selbst nimmt, verwandelt.
Wenn Anfang Sommer 1908 die Hinwendung Picassos zum Genre des Stilllebens auf gewisse Weise mit seinem damaligen depressiven Zustand, mit dem Bestreben, sich auf die Welt der einfachen Dinge zu stützen, erklärt werden kann, so eröffnete ihm bald darauf das lernbegierige und schöpferische Eindringen in die Eigenschaften der Darstellung objektiver gegenständlicher Gegebenheiten durch malerische Mittel den Weg zu einem völlig neuen Verfahren plastischen Denkens, das Kubismus genannt wurde. Es ist nicht zufällig, dass gerade das Stillleben mit seinem, nach einem Wort von George Braque, fühlbaren Raum, den man beinahe mit den Händen ertasten kann[78], zum häufigsten Sujet der kubistischen Malerei wurde.
Denn kein anderes Genre veranlasste in einem solchen Maße das konzentrierte analytische Eindringen in die Strukturprinzipien des Raumensembles der stabilen Formen, das durch die rhythmische Disziplin der rechtwinkeligen Fläche geordnet wurde. Für Picasso war der Übergang von den Formen der dreidimensionalen Skulptur zu den fühlbaren gegenständlichen Werken der Stilllebenkompositionen natürlich und logisch. Aber diese Tatsache verlagerte wiederum seine schöpferische Aufmerksamkeit von den mit der Skulptur verbundenen Problemen auf die Probleme eines anderen Ausdrucksmittels — des bildlichen.
Das Fehlen gesicherter Daten, das die Erstellung einer absoluten Chronologie des Protokubismus Picassos beeinträchtigt, ist vielleicht besonders fühlbar für die Periode zwischen seinem Aufenthalt in La Rue-des-Bois im August 1908 und seiner Reise nach Horta de Ebro Ende des Frühjahrs 1909.[79]
Wenn man die ganze Produktion dieser acht Monate insgesamt nimmt, d. h. alles an der Schwelle des Kubismus Geschaffene, so sieht es aus, als strebe der Gedanke des Malers gleichzeitig in mehrere Richtungen, verzweige sich in eine Vielzahl von Strömungen, die sich bald kreuzen und neue Lösungen synthetisieren, bald wieder wegtauchen, wie um ihre Zeit abzuwarten. Es bedarf einer das Material organisierenden Theorie der Evolution, aber vor allem muss man darlegen, welches der Antrieb der Bewegung war. Indem sie gleichsam post faktum das ideelle Ziel dieser Progression kennen, den Kubismus, betrachten die Forscher die Anhäufung in der schöpferischen Produktion Picassos vom Herbst 1908 bis zum Frühjahr 1909 als Symptome dieser „wichtigsten und radikalsten künstlerischen Revolution seit der Zeit der Renaissance“.[80]
Wie für das Jahr 1907 die Negerkunst als Faktor, der zur Entwicklung der klassischen Ästhetik beitrug, angesehen wird, so hält man jetzt die Lehren Cézannes für den Grundstein der neuen Progression. Es geht vor allem um die räumliche Konzeption der Leinwand als eines zusammengestellten Ganzen (Denis), das einem gewissen konstruktiven System untergeordnet ist. George Braque, dem sich Picasso im Herbst 1908 annäherte, der von der Übereinstimmung des malerischen Suchens Picassos mit seinem eigenen erstaunt war, und der mit ihm gemeinsam den Kubismus sechs Jahre lang anführte, erklärte, dass die „Hauptrichtung des Kubismus die Materialisierung des Raumes war“.[81] Jedoch nicht des traditionellen optischen, illusorischen Raumes, der durch die Mittel der Renaissanceperspektive geschaffen wird, sondern des neuen Raumes, den er „taktil, manuell“ nannte und den er mit den Stilllebenkompositionen, mit der tonalen Farbenskala und den auf Cézannesche Weise modulierten Pinselstrichen zu erfassen suchte. „Allererster Anfang“, sagte Braque, „ist der Kontakt mit Cézanne. Es war mehr als nur Einfluss, es war eine Einweihung. Cézanne brach als erster mit der wissenschaftlichen, mechanischen Perspektive, die von den Malern im Laufe von Jahrhunderten praktiziert wurde und die zum Ausschließen jeder anderen Möglichkeit führte“.[82]
Aber wenn für Braque die Landschaften und die Stillleben des Meisters aus Aix vor allem als Lehren für den gut temperierten Raum dienten, in dem die Gegenstände nur plastische Statisten sind, so empfand Picasso bei Cézanne auch dessen emotionale Kraft gegenüber seinen Sujets: Jenes von der malerischen Eigenwilligkeit gefesselte romantische Drama der Empfindungen und Erlebnisse, zu dem immer wieder die Birnen auf dem Teller, die weitverzweigte Kiefer in den Felsen, der mächtige Berg Sainte-Victoire oder die nackten Badenden am Waldsee herangezogen werden. Und in dem sogenannten Cézannismus Picassos (im Unterschied zu dem von Braque, und trotz ihrer technischen und stilistischen Nähe) findet man immer eine romantische Haltung dem dargestellten Motiv gegenüber, sei es ein Stillleben, eine Landschaft oder eine Gestalt (letztere interessierte Braque überhaupt nicht, ganz zu schweigen vom Porträt). Cézanne sagte von sich, dass er der Primitive der neuen Kunst sei (wie die großen „Primitiven“ in den Museen). Bereits im Jahre 1904 bezeichnete der mit Cézanne befreundete Maler Charles Camoin diesen als „Altmeister der Primitivisten der Freilichtmalerei“[83], und gerade dieses primitive Element der Cézannschen „wilden und zugleich raffinierten“ Natur (C. Pissarro), empfand ganz besonders Picasso, der schon immer den instinktiven, vorbewussten Anfängen des Schaffens gegenüber hellhörig war.
Aus diesem Grund erwarb er auch für nur wenige Francs im Laden eines drittrangigen Kunsthändlers ein großes, von dem Zöllner Rousseau gemaltes Frauenbildnis, das ihn in Erstaunen versetzt hatte und von dem er schon früher durch Alfred Jarry, einem alten Bekannten, gehört haben könnte. Aus Anlass dieser Erwerbung veranstaltete Picasso bei sich im „Bateau-Lavoir“ das durch die Chronisten berühmt gewordene Bankett zu Ehren Rousseaus. Die ehrlich gemeinte und rührende Ehrung degenerierte zu einer Mischung aus Volksfest und Bohèmefarce. Dies geschah im November 1908. Wahrscheinlich um die gleiche Zeit schuf Picasso eine kleine Gruppe von Stillleben, die seine Begeisterung für die Kunst Rousseaus offenbaren.
Eines davon ist das Bild Blumenstrauß in grauem Krug und Weinglas mit Löffel. Der von Picasso dargestellte Blumenstrauß scheint in den üppigen Wäldern des Zöllners gepflückt: In den verschiedenartigen Blüten und Blättchen, den glänzenden Blättern dieser Blumen lebt dieselbe Exotik, das gleiche unheimlich Geheimnisvolle. Aber in der betonten Alltäglichkeit und der prosaischen Einfachheit des Milieus gibt es zugleich auch die nüchterne Objektivität der realen Tatsachen; und mit der Vergröberung und Vereinfachung ihrer Details, der gewollten Plumpheit ihrer Proportionen, der matten Polychromie erinnern diese Pflanzen deutlich an unnatürliche Wachsblumen — Erzeugnisse von provinziellen Handwerkern, wie zum Beispiel die Eltern von Fernande Olivier. Vor allem vor der scheinbaren Lebensfähigkeit der unnatürlichen Pflanzen ist Picasso bezaubert und hypnotisiert. In ihnen errät er wie in verzauberten Wesen eine andere Beseeltheit, die er durch die Gegenüberstellung mit dem eindeutig abstrakten, aber auch an eine Blüte am Stiel erinnernden Umriss des wie Eis durchsichtigen Weinglases betont. Durch diesen Effekt einer fast feierlichen Repräsentation behauptet der Maler den Wert seines Motivs, und der Strauß auf der Oberfläche der massiven Kommode mit herausziehbarer Schublade gleichsam auf einem Piedestal, der für sich genommen nicht einer geschmacklosen, pseudovolkstümlichen Dekorativität entbehrt, lebt auf durch die nervöse Dynamik der nach allen Seiten gerichteten Blumenohren und - augen, der Blättergesten, des lautlosen, farbigen Akkords vor der rauen, tristen, spanischen Atmosphäre des Hintergrundes.
„… Sehen können, das heißt die Benennungen der Dinge vergessen“, schrieb Paul Valery[84], die Vision eines Malers charakterisierend. Picasso aber, indem er zu sehen verstand, vergaß nie die Benennungen dessen, was von ihm aus einer tiefen seelischen Neigung heraus dargestellt wurde; er durchschaute die Realität seiner Gegenstände und fand für sie entsprechende gestalterische Äquivalente. In allen Perioden seines Schaffens ist das Sujet, das gegenständliche Motiv nicht gleichgültig und nicht willkürlich, da für ihn vom Motiv der poetische Antrieb seines Schaffens ausgeht. Und wenn das kubistische Verfahren der taktilen Kreisuntersuchung für Picasso wie für Braque, die beiden Pioniere des Kubismus, das Verfahren der vollkommenen Erfahrung des Gegenstandes war, so nur mit dem Unterschied, dass es für Braque ein Gegenstand des künstlerischen Interesses und für Picasso ein Gegenstand der Liebe war. Hat also Picasso, sich über das Gestalterische um des reinen ästhetischen Zieles willen hinwegsetzend, sich von der Abstraktion verführen lassen? In seiner Phantasie herrschten die Gegenstände der Liebe, und sogar an der Schwelle des Kubismus (im Winter 1908/1909) dominierte in seiner Malerei das Moment der Repräsentation über das Problem der strukturalen Einheit des Gemäldes.
In dieser Periode der vielfach verzweigten Suche scheint Picasso im Unterschied zu Braque keine besondere Mühe zu haben mit dem Problem, „ein Bild zu machen“; es ist, als sei er von seinen Bildern besessen. Aber im Verlauf der Arbeit ändert sich dieses Material wie nachgiebiges Wachs, transformiert sich unter seinen Händen in neue Lösungen. Man muss sich (und dabei helfen einige seltene Fotos) die Arbeitsatmosphäre im Atelier des Malers vorstellen, wie er gleichzeitig einige Bilder „vorantreibt“, indem er sich von dem eben Gefundenen wieder trennt oder es wiederholt oder… So entstehen Serien, oder besser gesagt, Familien von Bildern, Zeichnungen, Skizzen zu Stillleben, Stillleben im Interieur, Köpfe, Figuren im Interieur mit Stillleben, Sujetszenen, Landschaften ohne und mit Figuren, die auch Szenenkompositionen bilden.
Zugleich aber waren es auch die Hinwendung zum Piktoralen, die Entdeckung des Zöllners Rousseau als eines gewissen von der akademischen Ästhetik nicht verdorbenen „Überbleibsels“ des primitiven oder naiven Bewusstseins und auch der Anfang der Freundschaft mit Braque („Es war so, als hätten wir einander geheiratet“, sagte Picasso[85]), die seine schöpferische Einsamkeit durchbrachen und ein Element der Mäßigkeit und der Klarheit des Geistes mit sich brachten, wie es der französischen Schule eigen ist. Das alles bedingte auch eine größere Offenheit Picassos den malerischen Lösungen der Maler der Vergangenheit und der Gegenwart gegenüber, als es zuvor der Fall gewesen war. Übrigens scheint das für die Periode des aktiven Suchens und der Experimente ganz natürlich.
So polemisiert gleichsam der Weibliche Akt aus der Ermitage, der zu derselben Gruppe von Bildern gehört wie der Akt am Meeresstrand aus dem Winter 1908-1909 mit Matisse (zum Beispiel mit dem Gemälde Luxus II, 1908), mit seiner Tendenz, die Figur als eine flache farbige Arabeske darzustellen — das hauptsächliche Element eines bereits reifen, dekorativen, großen Stils. Picasso interessiert im Gegenteil die Figur als solche, die Figur als körperlicher Apparat, der, nach der treffenden Äußerung Tugendholds an und für sich ein „mächtiger Mechanismus der Ausdruckskraft“ ist. In dieser Hinsicht hat der Ermitage-Akt, so paradox das auf den ersten Blick auch scheinen mag, die Linienführung der Studien Degas’ geerbt, dessen scharfes und objektives Analytikerauge in seiner Serie der nackten Frauen, die baden, sich waschen, abtrocknen, sich kämmen oder sich kämmen lassen, und auch in den Darstellungen der Ballerinen eine besondere „geometrische“ Rhythmik und die räumliche Artikulation wechselseitig aufeinander bezogener menschlicher Formen in der Bewegung entdeckte. Es ist nicht zufällig, dass im Zusammenhang mit den Arbeiten von Degas Paul Valery sich an die „analytische“ Zeichnung einer Hand von Holbein erinnert: „… die Finger sind schon aneinandergelegt, halbgebogen, aber noch nicht vollendet, so dass die Phalangen die Form von veränderten Vierecken mit einem quadratischen Querschnitt haben.“[86] Freilich ist der vorkubistische Akt Picassos nicht so kubistisch wie die Zeichnung Holbeins; ihre anatomischen Deformationen sprechen von der sinnlichen Natur der Eingebung, von dem empirischen Erlebnis der Details, nicht von einer vorgefassten konstruktiven Idee.
Konstruktiv ist hier nur der künstlerische Wille Picassos, der, dem allgemeinen Gesetz der inneren plastischen Harmonie entsprechend, die dissoziierten Formen des körperlichen Mechanismus der Nackten, ihre verschiedenen räumlichen Aspekte zusammenbringt. Diese erstaunliche Neuerung (die übrigens schlicht und einfach auf Vergessenes, auf die piktogrammatischen Techniken der Maler des Alten Ägypten und Assyriens zurückgeht), eröffnete nicht nur das analytische Verfahren des Kubismus, sondern zugleich auch ein riesiges Feld vorher unbekannter Möglichkeiten der gestalterischen Metapher, und in diesem Sinne weist der Ermitage-Akt des Winters 1908 schon in die Zukunft, indem er, nach der richtigen Bemerkung von Zervos, ein Meilenstein der ganzen späteren malerischen Poetik Picassos ist.
Aus formalen Gegensätzen gewebt — der frontalen Ansicht, den Profilabrissen des Rumpfes, den rechten und linken Hälften, die durch das Licht der Massen deutlich werden, welche durch ein klares Liniengerüst ausgeglichen sind —, eignet jedoch der Gestalt der Nackten nicht umsonst etwas von dem labilen Stil des Manierismus an. Ihre unorthodoxe Anatomie mit den scharnierhaften insektenartigen Gelenkzusammenfügungen zitiert gleichsam aus dem Gedächtnis durch ihre verlängerten Proportionen und verdünnten Glieder entweder den winkeligen Bau der Venus von Cranach, die raffinierte Eleganz der Dianen der Schule von Fontainebleau oder die wollüstigen Wölbungen der Engel und Odalisken von Ingres.
Matisse parierte den Vorwurf der Hässlichkeit der Frauen in seinen Bildern mit der Phrase, dass er nicht Frauen mache, sondern Bilder. Picasso jedoch „macht“ in seinem Bild die Frau. Er konstruiert nüchtern die Gestalt eines menschlichen Wesens weiblicher Natur mit jungen Formen und winkliger Grazie der Bewegungen, und er beseelt seine Schöpfung durch die Dynamik der Drehungen, Gesten und durch das von oben links kommende, perlgraue kühle Licht, dem die Nackte gleichsam ihren Rücken hinhält und das ruhig und klar mit den warmen Ockertönen ihres Leibes harmoniert.
Eine andere Gestalt, männlicher Natur diesmal, schafft Picasso in der Gouache Mann mit verschränkten Armen, indem er eine ähnliche gestalterische Manier wie im Winter 1908-1909 verwendet. Alles an dieser uneleganten, aber kräftigen Halbfigur — angefangen von dem durch starke Verlagerung der Maße vergrößerten steilstirnigen Kopf auf dem mächtigen Hals bis zur Geste der gekreuzten Hände, die die Schultern zusammenführt, um die Athletik und Einheitlichkeit des Torsos zu betonen — zeigt weniger das abstrakte, formale Suchen Picassos als sein Streben, Ausdruckskraft zu erreichen, den männlichen Torso in seiner körperlichen Konkretheit zu zeigen. Die semantische Polarisation der bildhaften Welt der Malerei Picassos im Jahre 1908, die Grundbedeutungen seiner persönlichen Mythologie bleiben auch jetzt, an der Schwelle einer neuen Entwicklungsetappe seiner formalen Konzeption, erhalten.
Doch Picasso konnte damals noch nicht wissen, dass er in die Periode des Kubismus eintrat. „Um zu wissen, dass wir Kubismus machten, hätten wir ihn kennen müssen! Tatsächlich aber wusste niemand, was das war.“[87] Indem er sein Schaffen aus dem Inneren erlebte und selbst als Zentrum und Quelle seiner eigenen Kunst auftrat, verfügte Picasso über eine umfassendere und weniger konventionelle Vorstellung von den Zielen seiner Arbeit, als heute von den Kunstkritikern angenommen wird. „Das Ziel, das ich mir stellte, indem ich Kubismus schuf? Malen und nichts weiter. Malen, um eine neue Expression zu suchen, ohne den nutzlosen Realismus, aber mittels einer Methode, die nur mit meinem Denken verbunden war, und ohne mich von der objektiven Realität unterjochen zu lassen.“[88] Wenn der Maler von der Suche nach einer neuen Expression spricht, so deshalb, weil seine professionelle Sorge darin bestand, adäquate Ausdrucksmittel zu finden, eine adäquate Sprache für bestimmte inhaltliche Antriebe, die seinem Denken eigen waren. Mit Recht sagte er: „Am Anfang des Kubismus experimentierten wir […], ein Bild zu machen war weniger wichtig, als die ganze Zeit Dinge zu entdecken.“[89] Heute jedoch, ein Dreivierteljahrhundert nachdem das formale Phänomen des Kubismus, darunter auch des frühen, genügend detailliert und gründlich untersucht wurde, kann man diese Kunstrichtung nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Selbstentwicklung der Form her einordnen, sondern man muss sie mit einem umfassenderen Blick, der feinfühlig auch die inhaltlichen Werte erfasst, betrachten.
Blumenstrauß in grauem Krug und Weinglas mit Löffel, 1908. Öl auf Leinwand, 81 x 65 cm. Ermitage, St. Petersburg.
Der Mann mit verschränkten Armen, 1909. Gouache, Aquarell, Bleistift auf Papier, auf Karton geklebt, 65,2 x 49,2 cm. Ermitage, St. Petersburg.
Tatsächlich besitzt fast jede Arbeit im Winter 1908 und im Frühjahr 1909 entweder einen eigenen Gehalt oder ist mit der Entwicklung eines Sujetvorhabens verbunden, oder es kristallisiert sich, wie im Falle des Stilllebens, ihr gegenständliches Motiv gleichsam in der Bildatmosphäre, die von bestimmten inhaltlichen Elementen durchdrungen ist, heraus. In dieser Periode entstand zum Beispiel das Gemälde Brote und Kompottschale mit Früchten auf einem Tisch, wo in der Form eines Stilllebens die aus mehreren Skizzen entwickelte Komposition des sogenannten Karneval im Bistro versteckt wird. In einem anderen Stillleben, gleichsam Cézanne zu Ehren, stellte der Maler eine Birne, eine Zitrone und den Cézanneschen Hut zwischen großzügigen Faltendrapierungen mit dem auf Cézannesche Art prachtvollen und strengen Blättermuster dar. Die in dieser Zeit gemalten Stillleben wenden sich gleichzeitig an das Gefühl für die Realität, an das künstlerische Gefühl und an die Phantasie des Zuschauers, weil sie, aus realen, sogar alltäglichen Dingen komponiert (zumeist Obst, Früchte, Tischbesteck), architektonisch geordnet sind und in ihnen jedesmal zugleich ein besonderer, energischer Ausdruck zum Vorschein kommt, den man gewöhnlich in einer Landschaft, einer epischen, dramatischen oder intimen, erwartet.
Das Ermitage-Stillleben mit Kompottschale gleicht einem Panoramablick („von einem Hügel“) auf eine Gruppe von Gegenständen auf der öden Oberfläche des runden Tisches. Mag sein, dass Picasso, die irreführende Empfindung einer Stilllebenlandschaft erkennend, das Bild deshalb unvollendet ließ und das Illusionäre darin aufrechterhielt, indem er die materielle Sachlichkeit der Gegenstände nicht bis zu Ende konkretisierte. Aber wenn dieses Projekt eines Stilllebens mit seinen „leeren Stellen“ und seinem logischen Plänewechsel im Endeffekt an den illusorischen Raum einer Landschaft erinnert, so erzeugt Picasso in seiner Landschaft Häuschen im Garten den Eindruck der Dreidimensionalität und der Tiefe mittels der Prinzipien des Braqueschen taktilen, manuellen Raumes von Stillleben. Und doch spricht hier das Fehlen des analytischen Geistes, eine Fülle von zerknüllten, nicht analysierten Formen im Motiv, gesuchte Künstlichkeit der verschnörkelt-rhythmisierten Arabesken der Linien nicht von der Suche nach dem materiellen Raum, sondern davon, dass dem Maler für die Verdichtung der Dramatik im Zusammenstoß der widerstrebenden Kräfte räumliche Begrenztheit nötig ist.
Eine dieser Kräfte ist die elementare Naturkraft mit ihrem ungestümen Wuchern der grünen Laubhütten und der pathetischen Gestikulation des trockenen Baumes, die andere ist die sinnlich geordnete Kraft mit den blinden Mauern und schneidenden Flächen der geometrischen Strukturen. Diese Dramatik, der die streng zurückhaltenden Beziehungen der kalten Mineralfarben und die Gespanntheit der auf der Spitze balancierenden Komposition dienen, überwindet die „Untätigkeit“ der reinen Landschaft, als erklänge hier der Widerhall von Konflikten der belebten Welt. Dieser Eindruck entspricht dem ursprünglichen Vorhaben Picassos, dieses Stück Natur zu dem Hintergrund einer Sujetkomposition mit Figuren zu machen, die er im Winter und Frühling 1909 beabsichtigte.
Sich auf die Verwandlung der Komposition des Karneval im Bistro in das Stillleben mit Broten und Kompottschale berufend, meint Pierre Daix, dass „man es nicht besser ausdrücken kann, dass in diesem Stadium jeder Gegenstand oder jede Gestalt vor allem ein bestimmter räumlicher Rhythmus, eine gewisse dreidimensionale Struktur ist, die ihre Partie in der Komposition zu spielen hat durch ihren Beitrag zur malerischen Struktur des Ganzen und nicht durch ihre eigene Realität. Und hier stößt er wieder an die Grenzen der Abstraktion. Er wird die Dame mit Fächer und die Königin Isabeau genauso wie die Stillleben behandeln.“[90] Meinungen dieser Art sind aber kaum gerechtfertigt, Picasso ist in diesem Stadium der Abstraktion noch ziemlich fern. Tatsächlich widerspricht sein Streben nach Fülle und Einheit der plastischen Struktur des malerischen Ganzen (wobei er sich auf die Cézanneschen Modulationen der Töne stützt, die den Formen ein Relief verleihen) nicht seinem fundamentalen literarischen Charakter und verletzt keineswegs die Realität der Gegenstände und Gestalten. Gerade die Metamorphosen der Szene im Baseler Stillleben offenbart klar den literarischen und nicht nur den plastischen Wert der sachlichen Motive des Stilllebens bei Picasso: Die Kompottschale ersetzt die Frauenfigur der Komposition, die Brote und die umgekippte Tasse, die Rhythmen und Formen zweier männlicher Figuren. Stillleben-Allegorie? Jedenfalls werden die Charaktere der Dinge und der Figuren bei Picasso unverwechselbar dem inneren Sinn nach in Einklang gebracht, wie das zum Beispiel bei der Königin Isabeau, der Dame mit Fächer und in der Arbeit Frau mit der Mandoline festzustellen ist.
Die pseudohistorische Königin Isabeau, die unmittelbar aus dem Gestaltenkreis des verworfenen Karneval im Bistro stammt, stellt dem Sinn nach eine Parallele zu dem Harlekin aus der Gesellschaft im Bistro dar, der in den Arbeiten Picassos nach drei Jahren des Vergessenseins wieder auftaucht.
Dieser nachdenklichen weiblichen Harlekinfigur in einem grünen, mit Laubmustern überschütteten Gewand und mit einer pseudomittelalterlichen Haartracht ist eine, auch mit pflanzlichen Formen verzierte, „gotisch“ mit Früchten gefüllte Kompottschale an die Seite gestellt. Die überall verstreuten pflanzlichen Anspielungen sind Metaphern des ewig Weiblichen, dieses Mal in der Gestalt einer kostümierten mittelalterlichen Schönheit. Nicht nur durch die Gestalt selbst, sondern auch durch die Stilisierung der Arabesken und der flachen Ebenen, durch die kühle, etwas traurige dekorative Art erinnert das Gemälde an die alten Gobelins, die Picasso wegen der Kombination verallgemeinerter Formen mit den chromatischen Gradationen der Farbskala gefielen. Für Picasso sind Schlaf und Traum auch Attribute des ewig Weiblichen, aber in diesem Fall betont das Nachdenken oder Träumen der Harlekin-Isabeau über dem Buch gleichsam die lebensfremde Retrospektive der Dargestellten.
Warum aber das Mittelalter? Es handelt sich nicht um einen neuen Einfluss, sondern um die von Picasso empfundene gewisse Ähnlichkeit der stilistischen Züge des frühen Kubismus mit den spitzbogigen Formen und den entblößten Strukturen der Gotik und teilweise auch um jene von Mysterien erfüllte Atmosphäre der mittelalterlichen Legenden, die sein Freund Apollinaire atmete, der eben damals den Verfaulenden Zauberer für den Druck vorbereitete. Es sei auch erwähnt, dass in eben diesem Winter 1908/1909 im Schaffen Picassos einige weitere, auf die gleiche Weise wie die Königin Isabeau entstandene mittelalterliche Motive und Szenen auftauchen.[91]
Eine elegante Dame aus einer ganz anderen Epoche stellt die Dame mit Fächer dar, in der einige Zeitgenossen Picassos das Porträt einer amerikanischen Kunstliebhaberin erkannten. Die Ähnlichkeit war übrigens eine zufällige, obwohl etwas von einem Galaporträt im Gemälde durchscheint. Die elegante Dame mit dem keck auf dem Kopf sitzenden Hut und dem in Falten liegenden Jabot, mit dem gehobenen, geöffneten Fächer in der einen Hand und dem gesenkten, zusammengeklappten Regenschirm in der anderen, posiert in einem Sessel. Das Neue der malerischen Sprache dieses Gemäldes besteht offensichtlich darin, dass hier alle formalen Lösungen zu einer wunderbaren Einheit zusammengeführt sind, die uns das Nichtorthodoxe der Ausführungsweise vergessen und nur die Gestalt, ihren individuellen Ausdruck wahrnehmen lässt.
Der malerische Hintergrund, gesättigt von dem Spiel und Widerhall der rhythmisierten Ebenen, von den Abstufungen der farbigen Flächen und der kühlen silbergrauen Töne und Malachitfarben, ist ein Attribut dieser Gestalt, das wir auch in ihren Zügen wiederfinden. Der Blick der Dame mit dem Fächer fixiert unter dem breitkrempigen Hut hervor nüchtern und unverwandt den Betrachter; das Gesicht, dessen Ebenmaß von der leichten Verzerrung der Züge kaum beeinträchtigt wird, wirkt wie eine vom Licht herausgearbeitete und geglättete Maske; die Geste der angewinkelten Hand mit dem Regenschirm ist von affektierter Grazie, in der ganzen Figur ist das korrekte Stilgefühl einer Dame der Gesellschaft spürbar, wie einer Schwester der mysteriösen Unbekannten aus den Gedichten Alexander Blocks (so hat der Symbolist Georgi Tschulkow Picassos Gestalt empfunden).[92]
Während jedoch bei der weiblichen Harlekin-Isabeau der auf die Hand gesenkte Kopf, der niedergeschlagene Blick und die pseudohistorischen Gegenstände das Bild einer Königin aus einem romantischen Traum zeichneten, eines herrlichen Ungeheuers (Tschulkow), verhält es sich ganz anders mit der Dame mit Fächer: Zwei verschiedene Gesichtsausdrücke, für jede Hälfte der Maske ein anderer, in Verbindung mit der manierierten Haltung einer Städterin und der winkligen, beinahe knisternden Rhythmik ohne jede Plastizität, formen nicht ein Bild des ewig Weiblichen, sondern eine Art von Kleiderpuppe, die kein anderes Wesen als den äußeren Schein besitzt. Und während die Weiblichkeit der Königin Isabeau durch die Fülle der pflanzlichen Anspielungen (Laubmuster, die mit Früchten gefüllte Kompottschale, das smaragdene Grün des Kolorits) betont und „metaphorisiert“ wurde, ist hier das Attribut, das bildhaft die Dame mit Fächer charakterisiert, eine flüchtig umrissene leere Blumenvase.
In der Frau mit der Mandoline liegt der Zusammenhang der dargestellten Gegenstände und der Gestalt an der Oberfläche, denn er geht aus dem Sujet selber hervor: Die Frau spielt ein Musikinstrument, und die Bücher dienen als Attribut der intellektuellen Atmosphäre der Hausmusik. Andererseits kontrastieren die Reihen der Bücherregale durch ihre geordnete Regelmäßigkeit mit dem herabfallenden scharlachroten, romantisch flammenden, Strom des Vorhangs und den über die Stuhllehne rieselnden Falten des weißen Stoffes, die den emotionellen Zustand der Musikerin ausdrücken, die sich selbstvergessen dem Strom der Töne hingibt. Den Zusammenfluss der Musik und der Emotion der Frauenfigur gestaltet Picasso, indem er den Umriss der Frauengestalt dem Instrument gleichsetzt (es handelt sich eher um die Symbiose einer Laute und einer Gitarre als um eine kleine, elegante Mandoline), und sogar durch die Analogie des Aufbaus des Kopfes der Gestalt und des halbsphärischen Körpers der Mandoline.
Kompottschale, Früchte und Weinglas (Stillleben mit Kompottschale: Schale mit Früchten), 1908-1909. Öl auf Leinwand, 92 x 72,5 cm. Ermitage, St. Petersburg.
Häuschen im Garten (La Rue-des-Bois), 1909. Öl auf Leinwand, 92 x 73 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.
Königin Isabeau, 1908-1909. Öl auf Leinwand, 92 x 73 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.
Um dieser Analogie willen analysiert und arbeitet Picasso nochmals mit harten Linien und einfachen Flächen die „Skulpturplastik“ des Kopfes der Musikerin heraus und gibt ihr, im Unterschied zu den Händen, nicht „Fleisch-“, sondern „Holz-“ Töne. Er setzt den Frauenkopf der Mandoline gleich, die Frau dem Instrument, und zwar nicht nur literarisch, sondern auch plastisch. Halten wir diesen Moment als außerordentlich wichtig fest. In der Frau mit der Mandoline steht Picasso schon an der Schwelle einer Entdeckung, die künftig radikal die Prinzipien seines Schaffens verwandeln wird — das Bild, das wie eine visuelle Metapher gebaut ist. Er steht an der Schwelle der Entdeckung der „plastischen Poesie“. Es werden zehn Jahre vergehen, und der Dichter Blaise Cendrars, auf die eben vergangene Epoche des Kubismus zurückblickend, wird bemerken: „Ich sage nicht, dass Picasso Literatur macht (wie Gustave Moreau), aber ich behaupte, dass er als erster in die Malerei einige „Kunstgriffe“ einführte, die davor nur als speziell literarisch betrachtet wurden.“[93] Es geht um die „visuelle Metapher“, die Picasso selbst „trompe-l’esprit“ nannte und die etwas später, in der Epoche der verbalen Einfügungen und der Collagen, den Ton angeben wird.
In einem Gemälde wie die Frau mit der Mandoline gibt es noch viel vom trompe-l’œil, von dem Streben nach plastischer Konkretheit der Formen, nach räumlicher Überzeugungskraft aller Volumenverhältnisse, was zum Beispiel Matisse Anlass gab, den Kubismus als „eine Art des deskriptiven Realismus“ zu betrachten.[94] Im Grunde genommen ist der Weg von den trompe-l’œil zu den „trompe-l’esprit“ vom Standpunkt der Entwicklung der literarischen Techniken bei Picasso die Evolutionsrichtung des Kubismus. Parallel mit dem Werden dieses neuen schöpferischen Geistes verlief der Prozess der Reproduktion der Ausdrucksmittel selbst, die Schritt für Schritt in ihrer Reinheit und Ausdruckskraft begriffen wurden. Fortlaufend eroberte bei Picasso der Kubismus für die Malerei die Freiheit von den optischen Fiktionen, um so die plastische Sprache für das Schaffen visueller Metaphern nutzbar zu machen, sie zur Sprache der Poesie zu erheben.
Die unterschiedliche stilistische Zielsetzung, ja Widersprüchlichkeit der betrachteten Werke vom Herbst 1908 und Frühling 1909 zeugt vom Fehlen einer einheitlichen Richtung der formalen Evolution am Anfang des Kubismus bei Picasso (bei Braque ist in diesem Sinne alles einheitlicher und konsequenter, aber auch formaler). Der Grund dafür ist wahrscheinlich darin zu suchen, dass für Picasso der Antrieb seines Schaffens in dieser Periode stets das Sujet bleibt, obwohl es nicht immer mit Worten ausgedrückt werden konnte. „Wenn die Sujets, die ich ausdrücken wollte, mir verschiedene Ausdrucksverfahren vorgaben, zögerte ich nie, sie anzunehmen.“[95]
Eine gewisse Konsequenz und Folgerichtigkeit der formalen Evolution wird der Kubismus bei Picasso erst mit jenen Leinwänden erlangen, die während der Sommersaison des Jahres 1909 in Horta de Ebro geschaffen wurden, wohin er, nachdem er dort schon zehn Jahre zuvor die glücklichsten Augenblicke seiner frühen Jugend erlebt hatte, nun wieder zurückkehrte.
In Horta ist Picasso in seinem ganzen Bewusstsein von der Realität durchdrungen, und seine Kunst stellt wieder den Kontakt mit der ihn umgebenden Wirklichkeit her. Aber das geschieht vermittels der neuen „Optik“, die die Empfindungen des Malers in diesem rauhen Bergland mit der durchsichtigen klaren Luft und den sich auf den Felsenabhängen türmenden kubischen Bauten bestimmt. Diese „Optik“ ist von einer erstaunlichen puristischen Reinheit und Klarheit. Sie wischt alles Zufällige, Formlose und Unbedeutende weg, bringt alles Chaotische der ungebändigten Natur in Ordnung und verschärft dabei bis zum Höchstmaß die Vision der Formen als ein Spiel der räumlichen Kontraste, was zur Folge hat, dass das Sichtbare den Aspekt eines Panoramas der Brechungen annimmt, die dem Charakter des Motivs entsprechend rhythmisch angeordnet sind. Und das ist es, was zum Grundstein der formalen Ausdrucksmittel des Kubismus wird. Aber man muss betonen, dass die Präzisierung der Volumen nicht von vorgefassten Ideen und ihrer Analyse um der Analyse willen ausging, sondern vom Erleben der Realitätstiefe dieses Landes mit den scharfen Konturen der Landschaft unter dem schonungslosen Licht der spanischen Sonne. Die Unversehrtheit dieses Erlebnisses wird für eine gewisse Einheit der in Horta de Ebro angefertigten Bilder sorgen, seien es Landschaften, Menschendarstellungen oder Stillleben.
Die Ermitage verfügt über eine in jenem Sommer geschaffene Landschaft — Die Fabrik (Horta de Ebro). Der dokumentarische Titel des Bildes zeugt von der Realität des Motivs, das jedoch durch die Phantasie Picassos verklärt und durch seine Träume ausgeschmückt erscheint, denn die die Rauheit der immergrünen Palmen ist nach dem Eingeständnis des Malers von ihm erfunden: Es gibt sie weder in Horta noch in der Umgebung des Ortes. Die Gruppe der einfachen, geometrischen Bauten strahlt mit ihren eckigen, zerstückelten Rhythmen in verschiedene Richtungen, ähnlich einem Thema, das sich wie eine Art räumlicher Fuge in die Tiefe und nach oben entwickelt. In ihrem verzaubernden Spiel der glatten silbriggrauen und ockerfarbenen Facetten verwandelt sich die Landschaft mit der Fabrik in eine prismenartige Spiegelung, die aus der mit gleißendem Licht erfüllten klaren Luft der katalonischen Berge entsteht. Das Leben dieser lichtüberfluteten Atmosphäre, die die Formen nicht, wie im Norden, verhüllt und verwischt, sondern sich scharf und heftig an ihr bricht, ist in erstaunlich farbigen Brechungen des Himmels dargestellt, der als Strukturkomponente in die Lösung des Ganzen eingeht.
Die Gemälde, die Picasso in Horta de Ebro schuf, zählen zur Klassik des analytischen Kubismus. Die Lösung dieses formalen Problems abschließend, wendet sich Picasso bereits im Herbst, nun wieder in Paris, der Skulptur zu, dem seiner Meinung nach besten Kommentar, den ein Maler zu seiner Malerei abgeben kann, um in analytischer Manier den Frauenkopf zu modellieren. Das traditionelle Prinzip der einheitlichen Skulpturmaße nicht verletzend, modelliert Picasso die Oberfläche mit klar hervortretenden Trennungslinien der schiefen Flächen; diese starken Muskelakzente der konstruktiven Fugen setzen ein Spiel der eigenen Rhythmen fort, aber zerreißen die „Haut“ (Kahnweiler) der Skulpturoberfläche. Sich nach Jahrzehnten an den Frauenkopf erinnernd, sagte Picasso zu Penrose: „Ich glaubte, dass die Kurvenlinien, die an der Oberfläche zu sehen sind, sich innen fortsetzen mussten. Ich hatte die Idee, sie aus Draht zu machen.“ „Aber“, bemerkt Penrose, „die Lösung gefiel ihm nicht, da, wie er hinzufügte, ‘es zu intellektuell, der Malerei zu ähnlich gewesen wäre’.“[96]
An die intellektuelle Atmosphäre der Arbeit im Atelier erinnert vor allem die Junge Dame, die im Winter 1909 geschaffen wurde. Zu dieser Zeit übersiedelte Picasso aus dem elenden „Bateau-Lavoir“ in eine komfortable Atelierwohnung am Boulevard de Clichy, am Fuße des Montmartre-Hügels. Das große, nach Norden hinausgehende Fenster des Ateliers bot das gleiche silbrige Licht, das Corot und Cézanne so liebten, daher zum Teil jener unerwartete Geschmack am Valeur, der in dem Ermitage-Bild zu sehen ist. Diese farbige Malweise beseelt die ganz und gar untraditionelle Lösung der Entblößten im Sessel, die eher ein frauenähnlicher Kristallleib ist, der auf den ersten Blick durch seine „Deformationen“ überrascht. Picasso malt diese Bilder, indem er dicht an die Leinwand heranrückt; er entfernt sich nicht, um den allgemeinen Effekt, der ihn nicht interessiert, zu beurteilen. Seine Arbeit ist weniger dekorativ als psychologisch. Sehr einfühlsam bemerkte der russische Kritiker Innokenti Aksjonow: „Picasso fixiert seine Gegenstände so nah, wie man das Gesicht einer Geliebten betrachtet. Um zwei Gegenstände gleichzeitig zu sehen, muss er den Kopf wenden, und auf seiner Leinwand trägt er die Breite der Komposition in die Tiefe.“[97] Daraus entstehen bei Picasso, dem „Maler aus Berufung, dem Erneuerer der Natur, dem Widerspruchsgeist“ (Sabartés), solche Deformationen, mit denen er gleichsam sagt, dass es keine schönen Gegenstände gibt, sondern nur die Kunst (Aksjonow).
Der Gegenstand seiner malerischen Forschung liegt nicht an der Oberfläche. Braque schreibt später über sich und den Picasso jener Zeit: „Wir waren vor allem sehr konzentriert.“[98] Mitunter besuchte Picasso die Ateliers der Freunde, um nach einem Modell zu zeichnen, um das Gefühl der Natur zu empfinden, den inneren Charakter dieses oder jenes Modells, einer Frau mit individuellen Zügen, Rhythmen, Proportionen.
In der Zurückgezogenheit des eigenen Ateliers porträtierte er dann danach seine Erinnerungen, indem er Details mit Hilfe seiner Methode präzisierte. Aus diesem Grund ist der Eindruck der Konkretheit einer Gestalt, der Individualität einer modernen Städterin, eines Modells, den zum Beispiel die Junge Dame hinterlässt, nicht zufällig. Ihren Charakter versteht man umso besser, je länger man sie betrachtet. Aber vom Standpunkt des Kubismus ist dieses Bild nur ein Kettenglied in der Reihe von Studienarbeiten, die zu immer größerer Zersplitterung des gegenständlichen Volumens mittels der Valeurs und der Dissoziation des Volumens in kleine geometrische Flächen, zur Schaffung einer eigenartigen esoterischen Sprache des analytischen Kubismus führen.
Picasso begrenzte seine Ausdrucksmittel auf Effekte der Beleuchtung im Raum: durch die Valeurs und Flächen. Sowohl das eine als auch das andere sind konventionelle Elemente der analytischen Vision der Maler, ein Instrument des Ordnens ihrer visuellen Empfindungen, um die Tiefe der Bildfläche wiederzugeben. Dieses Problem ist ungeheuer schwierig. Noch Cézanne klagte ständig darüber, dass die Flächen ihm entgehen. In seinen Bildern organisierte er die Tiefe durch stufenartige farbige Umrisse, die er, den Ruten eines Korbes ähnlich, in ein einheitliches malerisches Ganzes einflocht, das durch das vibrierende Leben der Formen gesättigt ist. Aber der Farbenreichtum ist ein besonderes Problem. „An der Farbe“, sagte Braque, „interessierte uns nur das Licht. Das Licht und der Raum sind zwei miteinander gekoppelte Dinge, nicht wahr? Und wir führten sie zusammen... Aber man nannte uns Abstrakte!“[99] Das Licht und der Raum sind in den Augen des Malers die Konkretheit, aber die Valeurs und die Flächen sind fast eine genau solche Abstraktion wie Buchstaben, aus denen Worte entstehen, die Gedanken oder Dinge ausdrücken.
Die auf verschiedene Weise geneigten, winklig umrissenen, rauchfarbenen und halbdurchsichtigen Flächen werden ähnlich Metallspänen um einen Magneten angeordnet, um sich so auf eine unbegreifliche Weise zu dem auf den ersten Blick erkennbaren Porträt Ambroise Vollard zusammenzufügen. Die Ränder der Flächen werden zu Elementen der Zeichnung, erstellen die Charakterzüge des Gesichts, die Details der Kleidung: den Knopf, den Kragen der Jacke, das Tuch in der Brusttasche und das Interieur: eine Flasche auf dem Tischchen. Als löse er das Problem der Quadratur des Kreises, baut Picasso die Kuppel des Kopfes des Modells durch eine aus der anderen hervorgehenden Fläche auf. Mit starken Strichen arbeitet er die Grundlinien und die Maße des schweren schlafenden Gesichts Vollards mit der kurzen, gebrochenen Nase und der harten Mundlinie heraus.
Trotz des nicht-imitativen Charakters der plastischen Sprache Picassos, der bereits (am Anfang des Jahres 1910!) „nicht von der Natur, aber mit ihr zusammen, ihr ähnlich arbeitet“[100], kann man nicht umhin, die beklemmende Genauigkeit der feinfühligen farbigen Abstufungen zu empfinden, sie verleiht der Gestalt des Porträts die Lebenskraft trotz — oder dank? — der augenscheinlichen Bedingtheit der sie bildenden Formen. Vollards Gesicht zieht die Aufmerksamkeit an.
Indem man seine energischen harten Falten betrachtet, versteht man, warum Cézanne, der dessen Porträt vor zehn Jahren gemalt hatte, diesen gutsituierten und bekannten Kunsthändler aus der Rue Laffitte einen „Sklavenhändler“ nannte. Aber es gibt in dem lethargischen Ausdruck des Vollardschen Gesichts auch einen Zug von Tragik: Einige spätere Fotografien hielten diese Tragik fest, aber sie kam auch früher zum Vorschein in der seiner Natur so eigenen Periode dunkler Sehnsucht und einer ihn ergreifenden somnambulen Erstarrung, ein Zustand, in dem er anscheinend auch für Picassos Porträt posierte. Indem das Moskauer Porträt Ambroise Vollard nach der allgemeinen Auffassung das Meisterwerk des analytischen Kubismus ist, ist es zugleich auch ein wahres Meisterwerk des psychologischen Realismus, der das verständlich macht, was 1910 als eine der Paradoxien des spanischen Malers empfunden wurde, und so bemerkte Metzinger: „Picasso erklärt sich offen für einen Realisten.“[101]
Bereits im Porträt Ambroise Vollard forderte die erhöhte Aufmerksamkeit den Farbnuancen gegenüber eine Maltechnik, die an die mosaikartige Manier der Divisionisten erinnert. Dank dieser Technik strahlt der Grundstoff gleichsam eine Lichtvibration aus, die nur durch die konstruktive Armatur der vertikalen, horizontalen und diagonalen Linien der Zeichnung geregelt wird, die sich weitaus nicht in allen Details gegenständlich lesen lässt.
Im Lauf der Jahre 1910-1911 entwickelten Picasso und Braque Seite an Seite diese hermetische Malerei, in der jedes Bild ein autonomer Sammelpunkt einer „reinen Realität“ war, die die umgebende Realität nicht imitierte. Und obwohl diese Bilder ihre eigenen Sujets hatten, in der Regel Stillleben und Musikergestalten, stützte sich die Realität dieser Malerei mehr auf komplizierte Empfindungen, die nicht immer konkret und mitunter nicht einmal visueller Art waren. Jahrzehnte später erklärte Picasso: „Man darf nicht alle diese Formen aus der Vernunft erklären. Damals redeten viele darüber, wieviel Realität im Kubismus sei. Tatsächlich aber begriffen sie ihn nicht. Das ist nicht die Realität, die man mit der Hand fühlen kann. Das gleicht vielmehr einem Duft, ist vorn, hinten, an den Seiten. Der Duft ist überall, ohne dass man genau weiß, wo er herkommt.“[102] In diesen hermetischen Bildern gab Picasso die Emanation der Realität wieder, die dank den lesbaren Anspielungen begriffen werden kann: der Umriss eines Weinglases, die Tabakpfeife, die Armlehne des Sessels, die Fransen der Tischdecke, der Fächer, der Violinegriff. Das ist jene konkrete Wirklichkeit, die überall war, immer zur Hand — im Atelier, auf der Straße, im Café. Bald (im Sommer 1911) dringt noch eine weitere Anspielung aus der ihn umgebenden Welt in Picassos Malerei ein — Straßenschilder, Zeitungsschlagzeilen, Worte auf Buchumschlägen, Weinetiketten, Tabakschachteln, Notenzeichen u. dgl., die immer thematisch mit dem Sujet des Gemäldes verbunden sind.
An und für sich figurierten Buchstaben und Überschriften auch schon früher in Bildern (z. B. bei Cézanne oder Van Gogh, um nur von den unmittelbaren Vorläufern Picassos zu sprechen) als Zubehör einer dargestellten Zeitung, eines Buches, eines Ladenschildes und dergleichen, aber der Gebrauch von verbalen Elementen bei Braque und Picasso hatte einen anderen Charakter und verfolgt ein anderes Ziel.
Zum einen sind die Buchstaben für beide Meister des analytischen Kubismus flache Formen, die die räumlichen Beziehungen im Bild herstellen helfen. Sie sind aber auch Elemente der umgebenden Realität, die an dem Sujetinhalt teilnehmen, seinen gegenständlichen Plan unterstützen, zumeist ohne verändert zu werden. Außerdem sind Worte und Phrasen, Wortfetzen und Silben für die Maler, die im engen Kontakt mit den Dichtern standen (das gilt besonders für Picasso), auch verbale Bilder, die in sinnliche Wechselbeziehungen mit den darstellenden Realitäten des Bildes treten, wodurch das Bild an Vieldeutigkeit gewinnt.[103] Auf der Leinwand mit den plastischen Formen vereint, steigern die verbalen Schriftelemente zugleich die assoziative Bedeutung der gegenständlichen Motive, stimulieren ihre Buchstäblichkeit und schließlich das Wiedererkennen. Aber die Kombination von zwei bildhaften Ebenen führt zur Verwandlung des Gemäldes in eine vieldeutige Scharade, einen Kalauer, eine totale Metapher — ein Effekt, der von Picasso am höchsten bewertet wurde.
In dem Bild Ein Tischen im Café, das im Frühjahr 1912 geschaffen wurde, gehören die Buchstaben, die im Hintergrund verlaufen, den Reklametexten an, die auf das unsichtbare Glas der Cafévitrine aufgetragen sind, das den Hintergrund des Stilllebens bildet. Dank ihrer Anwesenheit ist das Bild von unzweifelhaft erkennbaren Kennzeichen des modernen, urbanisierten Lebens durchdrungen, während das Motiv der Komposition selbst — die Flasche „Pernod“ und das Weinglas mit dem Zuckerlöffel, die auf dem ovalen Holztischchen stehen — den neuen Geschmack Picassos an der materiellen Konkretheit der Welt offenbart. Der Maler ist sichtlich von dem Kontrasteffekt der Brechungen der körperlosen gläsernen Gegenstände und der dichten welligen Textur in dem warmen Holzton hingerissen. Gleichzeitig ist die Schriftimitation der Vitrinenreklame nicht nur ein Element der Realität, sondern auch einer neuen Poetik: Die Fetzen von Überschriften knüpfen in ihrem Durcheinander wie auch durch ihre räumliche und sinnliche Zugehörigkeit zur Sphäre des Alkohols an die Vorstellung von dem harten und zugleich berauschenden zeitgenössischen Leben an.
Solche Ideen waren Picasso auch deshalb nicht fremd, weil gerade im Jahre 1912 Apollinaire sich auf das Erscheinen seiner ersten Gedichtsammlung unter dem Titel Alcools vorbereitete (ursprünglicher Titel: Eau-de-vie), für die Picasso Anfang des Jahres 1913 ein kubistisches Porträt des Autors gemalt hatte. In dem den Gedichtband einleitenden Poem Zone finden sich die ausdrucksvollen Zeilen:
Du liest Prospekte, Kataloge, Plakate, die laut singen
Das ist die Poesie dieses Morgens
und für die Prosa gibt es Zeitungen
Es gibt Ausgaben zu 25 Centimes...
Und du trinkst den Alkohol
den brennenden wie dein Leben
Dein Leben das du wie Branntwein trinkst…
„Wir sind keine einfachen Ausführer, wir durchleben unsere Arbeit“ — wiederholen wir hier das Bekenntnis Picassos, das uns daran erinnert, dass die Kunst dieses Malers immer Ausdruck seines Seins, seiner seelischen Erfahrung, seiner intellektuellen und geistigen Entwicklung, besser gesagt — der Entfaltung, Ausweitung und freien Verwirklichung seiner Persönlichkeit ist. Nach der angenommenen Klassifizierung wandelte sich der Kubismus Picassos während der ersten Hälfte des Jahres 1912 vom analytischen zum synthetischen. Irgendwann Anfang des Jahres reift in Picasso das Bedürfnis, mit real greifbaren Formen zu arbeiten — mit der Skulptur. Zugleich eröffnete die Einführung von Buchstaben und Überschriften in das Bild als Tatsachen der Realität den Weg auch zu den anderen Dingen der Wirklichkeit: Etiketten verschiedener Materialien mit schon fertigen Schriftenformen, Vignetten, Ornamenten — es entsteht die Technik der Collage. Das sind die Merkmale dieses Übergangs, der vom Zusammenfließen einer Vielzahl von Umständen und Ereignissen bedingt wurde, von denen die inneren nicht die geringsten waren.
Dieses so unmittelbare, eindeutige Durchdringen der Realität signalisiert das Ende jener körperlosen, hermetischen und anonymen Malerei des analytischen Kubismus, die Picasso im Laufe von anderthalb Jahren in engster Zusammenarbeit mit Braque entwickelte, indem er beinahe zu dessen Doppelgänger wurde (ihre Bilder der Jahre 1910-1911 sind leichter auszutauschen als zu unterscheiden). Die Umorientierung stützte sich auf die sich zuspitzende sinnliche Empfindung der Welt, auf die Umwertung der äußeren Antriebe: der farbigen Mannigfaltigkeit, des Reichtums der materiellen Eigenschaften. Und diese Erneuerung der künstlerischen Vision ist der Widerhall eines inneren Erlebnisses, das wirklich fähig ist, den Charakter der Empfindungen und Gedanken umzubauen, der Widerhall des Gefühls zu einer Frau. Diese Gesetzmäßigkeit ist schon seit langem bemerkt worden — die Liebe bringt Veränderungen in die Kunst Picassos. Daraus resultiert das Liebäugeln mit den Texturen des Stoffes, mit den Effekten der Kontraste, das Erscheinen lebendigerer und fröhlicherer Farben. Gemeinsam mit Eva, deren Name für ihn Symbolcharakter hatte, beginnt Picasso ein anderes Leben, das neue Obertöne in sein Schaffen bringt. Im Sommer und Herbst des Jahres 1912 wohnt Picasso zusammen mit Eva in dem südlichen Städtchen Sorgues und ist buchstäblich von einem Sujet besessen: Anderthalb Dutzend Bilder dieser Saison sind der Darstellung von Violinen und Gitarren gewidmet. Das ist eine lyrische Malerei, die im Erlebnis der körperlichen Eigenschaften der allegorisch-weiblichen Instrumente eingeschlossen ist und danach strebt, eine harmonische und greifbare Gestalt aus den widerspruchsvollen Elementen der Form, des Rhythmus, der Stofftextur, der malerischen Oberfläche, der Farben zu schaffen. Diese Malerei schließt in sich eine sinnliche Vielfalt der Welt ein, und es ist kein Zufall, dass einige dieser Stillleben wörtliche Liebeserklärungen an Eva („Je t’aime Eva“) enthalten.
Porträt Ambroise Vollard, 1910. Öl auf Leinwand, 93 x 66 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.
Ein Tischchen im Café (Eine Flasche Pernod), 1912. Öl auf Leinwand, 45,5 x 32,5 cm. Ermitage, St. Petersburg.
Die Violine ist eines der ersten und harmonischsten Werke dieser Periode. Darin ist, nach den Worten des russischen Kubisten Alexej Gristschenko, „mit einer erstaunlichen Meisterschaft die neue Konzeption des Bildes gelöst, wo die Formen des Gegenstandes, die vom Maler gründlich verarbeitet werden, zu einer klaren, stilistisch vollendeten und aufregenden Komposition zusammengeführt werden; wo die analytisch gewonnenen Elemente in die Malerei eingeführt und zu einem unzertrennbaren, synthetischen Ganzen zusammengeschweißt sind, wo die Perspektive durch die realen Tiefenquerschnitte des Gegenstandes gegeben ist, wo jedes Stückchen der Leinwand unter der Hand eines wahren Malers entstand“.[104] Dieses Bild darf man kaum ein Stillleben im eigentlichen Sinne nennen: Sein konzeptionelles Vorhaben lässt sich eher in dem Begriff „Bild-Sache“ (tableau-objet) ausdrücken, der um diese Zeit von Picasso selbst verwendet wurde. Tatsächlich wird hier das malerische Bild der Violine schon durch die harmonische ovale Form des Gemäldes vorgegeben; und das Instrument ist in seinem Kompositionskern erkennbar dargestellt, seine materiellen Eigenschaften liegen offen zutage, die wellige Textur und die Honigtöne des Holzes wie auch die eleganten Details (die F’s und die Durchbiegungen der Decke). Dieser körperliche Kern tritt dank der Passagen der geteilten Formen, die rhythmisch zu den Rändern des Formats streben, fast sphärisch hervor. Die ganze Komposition gewinnt also ihre Standfestigkeit nicht dadurch, dass der Gegenstand selbst in einer gewissen festen Lage gezeigt wird, und auch nicht wegen des pyramidalen Gerüsts, sondern durch den kühnen Aufbau der ovalen, tektonisch sehr komplizierten Komposition, die durch ihren Kern, ähnlich einem Bogen durch den Schlussstein, gefestigt ist.
Die labile ovale Form der Leinwand, die nicht aufstellbar, sondern nur an die Wand zu hängen ist, brachte den Maler in die Versuchung, neue Kompositionsprinzipien für Strukturen zu finden, die so aussehen, als wären sie aufgehängt oder schwämmen im Raum des ovalen Formats selbst. So wird in dem Gemälde Musikinstrumente, an dem Picasso in demselben Sommer in Sorgues arbeitete, eine Kaskade von Formen, die den Umrissen, den Farb-, Raum- und Fakturencharakteristiken nach unterschiedlich sind, dauerhaft auf der Kreuzung zweier schwarzer Streifen befestigt, die als Fundament der Konstruktion dienen. Die ausdrucksvollen Kennzeichen der Instrumente weisen auf die Zugehörigkeit des reich entfalteten Ensembles der formalen Elemente der rosaweißen Violine, der gelbbraunen Gitarre und der dunkelgrün-blau-cremefarbenen Mandoline hin. Sie sind hier mit den dissoziierten Merkmalen ihrer charakteristischen Realitäten dargestellt — den Maßen, Ebenen und Oberflächen, Umrissen und Konstruktionsdetails, mit einer Art bildlicher Zeichen. Aber für Picasso sind diese Zeichen auch gewisse sinnliche Äquivalente, wovon ihre nicht natürliche, sondern ihre subjektive bildliche Färbung zeugt (scharfrosa, samtigblau und -grün, tiefbraun und sandgelb) und die Einführung eines stark fühlbaren Reizerregers, dem Gips, dessen Relief den Effekt eines „Geräusches“ hervorbringt. Gerade in Sorgues, wie aus den Notizen in seinem Skizzenblock ersichtlich ist, bemüht Picasso sich, „das Gleichgewicht zwischen der Natur und der Vorstellung zu finden“.[105]
Die Musikinstrumente — ein lyrisches Sujet unter anderen in den Augen Picassos — beschäftigen seine Einbildung noch mehrere Monate. Er strebt nach der Materialisierung seiner neuen Vision, und im Herbst 1912, bereits wieder in Paris, wendet er sich erneut den dreidimensionalen Formen der Skulptur zu, um eine Familie räumlicher Konstruktionen — der Gitarren — zu schaffen. Diese prinzipiell neuen, aus grauer Pappe geschnittenen „Skulpturen“ imitieren die realen Instrumente nicht, aber rekonstruieren ihre Bilder in den Termini der räumlich verbundenen, teilweise einander verhüllenden flachen Silhouetten, die offene Volumen bilden. Gerade diese neuen lyrischen Objekte (und nicht die realen, wie man oft denkt, die durch die grausame Vivisektion präpariert und aus denen danach irgendwie Gitarren und Violinen zusammengebastelt wurden) wie auch die ovalen „Bilder-Sachen“, die nur zum An-die-Wand-Hängen bestimmt waren, geben um die Jahreswende 1912/1913 den Anstoß zu den endlosen neuen Interpretationen von Musikinstrumenten in vielfältigen Kompositionen aus Farbpapier (Collage oder papier collé) und Bildern.
Zu den Arbeiten dieser Periode und Richtung gehören die Bilder Violine und Gläser auf einem Tisch und Violine und Klarinette, in denen das deutlich dominierende Konstruktionsprinzip durch die flachen frontalen Pläne auf den Zusammenhang der Technik des papier collé und mit den Skulpturkonstruktionen hinweist. Aber während das erstgenannte Bild als imposante, sicherere und mehr dekorativ entwickelte Version der kleinen ovalen Violine aus dem Moskauer Museum erscheint, ist das dem Äußeren nach schlichte Bild Violine und Klarinette eine meisterhafte Studie des neuen Aufbaus der Komposition und die auf das Äußerste reduzierte Formel der neuen bildlichen Konzeption der Malerei Picassos (oder noch umfassender, seines plastischen Schaffens), die im Laufe der sechs Jahre seiner kubistischen Periode reifte. Eine absolut flache schwarze Fläche weicht hinter eine braune zurück, mit der sie fest durch die Inkrustation des kleinen cremefarbenen Quadrats zusammengekettet wird.
So ein leicht und meisterhaft erreichter Effekt der Tiefe erklärt das räumliche Verhältnis beider Instrumente, die sparsam durch die einfache Zeichnung des Pinsels angedeutet sind. Dabei sind die Farben der Instrumente (die ebenholzfarbene der Klarinette und die kaffeebraune mit Holzadern der Violine) von ihren Umrissen dissoziiert und sogar in ihren Plätzen und in ihrer räumlichen gegenseitigen Lage
vertauscht. Gleichzeitig, aber nicht zusammen existieren die Farben der Gegenstände und die Formen, ihre Maße und Umrisse werden als unabhängig voneinander wirkende Kräfte begriffen, die ein Spiel miteinander und mit unserer Einbildung beginnen. Dieser erstaunliche Handgriff offenbart sehr deutlich die Anatomie der plastischen Metapher, die Picasso „trompe-l’esprit“ nannte und die nichts anderes ist als das poetische Bild, das, laut Garcia Lorca, „auf dem Wechselspiel von Gestalt, Bestimmung und Funktion verschiedener Gegenstände der Natur und ihrer Ideen“[106] beruht.
Mit einer erstaunlichen Freiheit, Findigkeit und Grazie wendet Picasso das Gesetz der plastischen Metapher in der die Möglichkeiten der Malerei revolutionierenden Collagetechnik an, d. h. der Papieretiketten, die er selbst so erklärte: „Außer den Rhythmen ist der Unterschied der Texturen eines der Dinge, die uns am stärksten in der Natur in Erstaunen versetzen: Die Transparenz des Raumes steht der Undurchsichtigkeit des in ihm eingeschlossenen Gegenstandes gegenüber, die Mattheit der Tabakschachtel neben der Porzellanvase; und dazu noch das Verhältnis der Form, der Farbe und des Volumens zur Textur. Wozu sollte man diese Unterschiede durch eintönige Pinselstriche der Ölmalerei zu erreichen suchen und damit das Sichtbare durch die Vielfalt der qualvollen und rhetorischen Bedingtheiten die Perspektive u. dgl. ‘wiedergeben’? Das Ziel von papier collé bestand darin, dass man zeigen wollte, dass verschiedene Stoffe in die Komposition eingehen können, indem sie im Bild zur Wirklichkeit werden, die sich mit der Natur messen kann. Wir strebten danach, uns vom ‘trompe-l’œil’ zu befreien, um ‘trompe-l’esprit’ zu erreichen.“[107] Keine von den ins papier collé eingehenden Komponenten wird in ihrem direkten Sinne genommen; es sind allesamt Allegorien und Metaphern.
In der Komposition Fruchtschale mit Weintraube und zerschnittener Birne ist das im Zentrum aufgeklebte Papierstück die Masse und die Farbe der Porzellankompottschale, die durch graphische Abrisse angedeutet ist: Das von unten angeklebte graue, marmorartige Tapetenpapier soll andeuten, dass die Kompottschale mit Weintrauben, die Birne und die Visitenkarte Picassos sich auf einem Kaminsims befinden. Und während die glänzende Oberfläche der Früchte wie auch des Gesimses wie negativ samtige Sägespäne wiedergegeben ist, so sind die Transparenz des Raums, seine Sättigung mit Luft und Sonnenlicht fast impressionistisch wiedergegeben — durch eine Zauberwelt leichter, einander durchdringender geometrisierter Ebenen, die aus kleinsten Teilchen bunter und freudiger Farben bestehen.
Ohne die Natur zu imitieren, vermittelt uns der Maler überzeugend die Atmosphäre eines von der Sonne durchtränkten, gemütlichen Zimmers. Auf anderen Empfindungen beruht das Bild Taverne, das Stillleben, das dem Firmenschild eines provinziellen Restaurants gleicht. Das ovale Format befreit den Maler von der Sorge über das Oben und Unten der Komposition, über die Ausfüllung der Ecken, und er komponierte das Stillleben mit einer erstaunlichen Ungezwungenheit, als sei es ein voll mit chaotisch aufgetürmtem Essen gedeckter Restauranttisch. Im Zentrum ist ein prächtiger rosafarbener Schinken, rechts eine Bierflasche, links ein Becher, durch den die Aufstellung der Gerichte auf einer schwarzen Schiefertafel durchscheint; im Vordergrund liegen eine Zitrone und Messer und Gabel auf einer zerknitterten Serviette; zu sehen ist das Menüblättchen und die blaue Aufschrift auf dem Glas „Restaurant“. Alles ist erzählt worden, mehr noch — alles ist spürbar.
Das Motiv ist aufs Äußerste an den Zuschauer herangebracht, fällt aus der Bildebene heraus, die Realität des Schinkens und der Zitrone, der Serviette auf dem Tisch, des scharfen Messers und der schweren Gabel verschärfend. Im Kontrast mit der greifbaren Faktur der Sägespäne sehen die schematisch dargestellte Flasche und das Glas so aus, als seien sie nur durchsichtige Phantome, die keine eigene Realität besitzen — was durchaus zutrifft, wenn sie leer sind. Unwillkürlich die Sujets der wollüstigen Überfülle bei den lebensfreudigen Flamen ins Gedächtnis rufend, steht die Taverne Picassos ihnen entgegen, indem sie unsere Empfindung auffordert, die routinierten, die Freiheit des Bewusstseins fesselnden Formen der künstlerischen Vision zu überwinden und an der Zeche des Geistes teilzunehmen.
Musikinstrumente, 1913. Wachstuch, Ripoline, Öl, Gips, Sägespäne, 98 x 80 cm (oval). Ermitage, St. Petersburg.
Violine und Gläser auf einem Tisch (Violine und Gitarre), 1913. Öl auf Leinwand, 65 x 54 cm. Ermitage, St. Petersburg.
Kleines Pferd, 1924. Tusche, Pinsel und Papier, 21 x 27,2 cm. Puschkin-Museum der bildenden Künste, Moskau.
Glas und zerschnittene Birne auf einem Tisch, 1914. Bemaltes, weißes und schwarzes Papier auf Karton geklebt, Gouache und Bleistift, 35 x 32 cm. Ermitage, St. Petersburg.
Fruchtschale mit Weintrauben und zerschnittener Birne, 1914. Gouache, Leimfarbe, Bleistift, Sägespäne, Papier auf Karton, 67,6 x 57,2 cm. Ermitage, St. Petersburg.
Die im Frühjahr 1914 angefertigten Taverne, Fruchtschale mit Weintraube und zerschnittener Birne, wie auch noch ein weiteres papier collé, Glas und zerschnittene Birne auf einem Tisch, waren unter den letzten Erwerbungen von Sergej Iwanowitsch Stschukin (1854-1937), eines reichen Moskauer Industriellen und leidenschaftlichen Enthusiasten der neuen Kunst, kurz vor dem Beginn des ersten Weltkrieges.
Als begeisterter Sammler, freigeistige Persönlichkeit mit tiefer künstlerischer Intuition, verstand Stschukin, nach eigenem Eingeständnis, nicht immer das damals in seinem Neuerertum so frappante Schaffen des jungen Spaniers. Aber ohne Zögern, wie nur wenige in jenen Jahren, begriff und erkannte er, dass der Künstler am Ende Recht behalten würde. In der heißen Polemik, die durch das revolutionäre Schaffen Picassos hervorgerufen wurde, äußerte sich der Moskauer Mäzen durch den Kauf von fünfzig seiner repräsentativen Bilder. Hätte er aber als Kritiker sprechen müssen, so würde seine Meinung mit den Worten eines Engländers übereinstimmen: „Ich verzichte offen auf jegliche Ansprüche, auf das Verstehen oder mindestens auf die Bewertung Picassos. Er versetzt mich ins Zittern. Ich betrachte ihn nicht — wozu manche Kritiker geneigt sind — als einen Verrückten. Sein Schaffen ist kein Sand-in-die-Augen-Streuen. Dessen bin ich sicher; und jeder, der mit ihm gesprochen hat, wird meine Sicherheit teilen... Picasso hat alles gemacht. Er hat zartfühlende Aquarelle von endloser Feinheit und großem Zauber gemalt. Er fertigte durch herrliche Linien bestechende Zeichnungen an, die uns eine wahre und einfache Schönheit offenbaren, und nun erreichte er den Punkt, wo nichts wirklich erklärt und nichts, soviel ich weiß, verstanden worden ist. Und dennoch erklärt er: „Ich gehe bis zum Ziel.“ Und da ich von der Genialität dieses Menschen überzeugt bin, da ich weiß, was er in der Vergangenheit geschaffen hat, mische ich mich nicht ein, zu viel wissend, um zu tadeln, zu wenig wissend, um zu rühmen — um zu loben, muss man verstehen, wenn es mehr sein soll als eine leere Phrasendrescherei... Ich fühle, dass Picasso in einem gewissen Sinne größer ist als die Größten, weil er etwas Größeres zu machen versucht.“[108]
Die für Besucher geöffnete Hausgalerie von Stschukin wurde bereits in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg tatsächlich zum ersten öffentlichen Museum der zeitgenössischen Kunst in der Welt. Nur drei Gemälde, freilich solche Meisterwerke Picassos wie Harlekin und seine Gefährtin, Mädchen auf der Kugel und Porträt Ambroise Vollard, stammen aus der Haussammlung eines anderen großen Mäzens, ebenfalls eines Moskauers, Iwan Abramowitsch Morosow (1871-1921). Aber während in der Morosowschen Galerie die ausgewählten Werke Picassos nach dem Willen des Besitzers die ihnen zugewiesenen Plätze in der nach Perioden und Richtungen
systematisierten Anthologie der neuesten Epoche der französischen Kunst einnehmen sollten, so sprach das persönliche Zimmer Picassos bei Stschukin eher von den eigenen Vorlieben des Sammlers. „Die ganze Sammlung“, schrieb B. N. Ternowez über die Galerie Stschukin, die er gut kannte, „gleicht den erstarrten Wellen der Begeisterung eines Sammlers: für die Werke von Monet, Gauguin, Matisse, Picasso, Derain.“[109] Diese Begeisterungswellen, widerspruchsvolle, wie es scheinen mag, überdeckten mitunter eine die andere. Aber nie leistete Stschukin Verzicht auf das Vergangene im Namen des Neuesten, und, während er mit Enthusiasmus das Schaffen Matisses weiter verfolgte, füllte er zugleich seine Sammlung mit Arbeiten Picassos und später mit denen von Rousseau und Derain auf.
Was Picasso betrifft, so ist hier die Begeisterung des Sammlers für den jungen Anführer der Pariser Avantgarde (ihres „Antimatisse“-Flügels), wenn man das unstete Temperament Stschukins, das ihn zu unbekannten Ufern zog (Ternowez) und den seiner Natur eigenen Hang zu Extremen in Betracht zieht, vollkommen erklärbar und verständlich. Diese Begeisterung begann nicht vor dem Jahr 1909.[110] Bereits im Herbst 1908 hatten Stschukin und Morosow in Paris einige Bilder von Matisse erworben, Morosow auch Picassos postimpressionistisches Harlekin und seine Gefährtin, von dem man weiß, dass es das erste Bild Picassos war, das in Russland auftauchte. Aber bereits im Jahr 1913 zählte die Stschukinsche Sammlung fünfunddreißig Bilder und Gouachen Picassos, zum Anfang des Jahres 1914 vierzig, und noch ein halbes Jahr später erreichte ihre Zahl fünfzig.
Die Gewichtigkeit dieser Sammlung war schon für ihre ersten Betrachter offensichtlich und wird auch bis heute nicht bestritten. Auch ist die Behauptung nicht falsch und nicht übertrieben, dass in jenen Jahren die Besucher der Stschukinschen Hausgalerie mit dem Schaffen des jungen Picasso weitaus besser und umfassender vertraut gemacht wurden als die Einwohner anderer europäischer Städte, Paris eingeschlossen. Denn Picasso schickte seine Arbeiten nicht in die großen Salons und vermied es, an Gruppenausstellungen teilzunehmen. Nur seine Arbeit interessierte ihn; er verkehrte nur im Kreis der Freunde und zog es vor, seine Arbeiten mittels eines Kunsthändlers zu verkaufen, ohne sich im geringsten um den Ruhm zu sorgen, den man durch Reklame gewinnen kann. Bei all der Begeisterung Stschukins für Picasso und all seinem tiefen Vertrauen zu ihm waren, wie schon erwähnt, nicht alle aus der Werkstatt des Malers stammenden Arbeiten, nicht alle seine künstlerischen Lösungen gleich akzeptabel für den russischen Mäzen. Stschukin besaß zum Beispiel nichts von den Arbeiten der Jahre 1910-1911, aus der am meisten hermetischen, gegenstandslosen Phase des Kubismus, die er vielleicht als zu spitzfindig einschätzte. Dafür war aber mit einer unwahrscheinlichen Fülle und mit den ausschlaggebendsten Arbeiten der monumental-archaische Protokubismus des Jahres 1908 und der raffinierte Cézannesche Stil des Jahres 1909 vertreten, die der Sammler als eine Art Fortsetzung der von ihm so geschätzten Blauen Periode betrachtete.
Diese Auswahl der Werke ergab sich aus der Besonderheit der Stschukinschen Vorstellung von Picasso als einem spanischen Künstler, einem strengen Asketen und Geisterseher, der auch etwas Dämonisches in sich hatte. Diese seine Konzeption erklärte Stschukin, der seine Gedanken in Kontrasten auszudrücken pflegte, mit einem lakonischen Aphorismus: „Matisse muss Fresken in Palästen bemalen, Picasso in Kathedralen.“[111] Folglich brachte Stschukin in seiner Empirevilla die Bilder Matisses in einem großen, hellen, schmucken Salon (Rosafarbenes Gästezimmer) unter und Werke des Spaniers in einem entlegenen gewölbten Zimmer, das Tugendhold einfach und ausdrucksvoll „Picassos Klosterzelle“ nannte.
Und genauso wie die Antithese „Palast — Kathedrale“ erschienen Matisse und Picasso dem russischen Publikum, was seine Folgen hatte. Wesentlich ist etwas anderes — Stschukins sparsame Formel spiegelt eine gewisse Empfänglichkeit für Matisse und Picasso in der russischen Kultur der postsymbolistischen Periode des ersten Jahrzehnts des 20. Jhs. wider. Da in Russland als traditionelles Kriterium des Verhaltens zum künstlerischen Schaffen die Frage „Wozu?“ gilt, ist es leicht zu verstehen, dass in der kulturellen Situation jener Epoche, der Epoche des gespannten geistigen Suchens, die „Kathedrale“ eine unbestreitbare Priorität vor dem „Palast“ hatte. Man kann sich davon überzeugen, wenn man in alten Zeitschriften und Broschüren Urteile über Matisse und Picasso von ihren ersten russischen Rezensenten liest.
An Matisse schätzte die russische Kritik, selbstverständlich die ernste Kritik, die ihn als einen kühnen Neuerer anerkannte, seine künstlerische Gabe und verstand die Größe seiner schöpferischen Persönlichkeit. Diese Kritik, die Matisse kannte, bemerkte an ihm mit kennzeichnender Beharrlichkeit nichts außer dem „Palast“, das heißt, das Bild eines dekorativen Paradieses, das den persischen und arabischen Glasurwänden, Teppichen und Stoffen gleichgestellt wurde.
Jakob Alexandrowitsch Tugendhold schrieb im ersten Heft des Apollon für das Jahr 1914: „In dem rosafarbenen Gästezimmer Stschukins darf man vielleicht nicht philosophieren, aber man darf sich auch nicht Tschechowschen Stimmungen hingeben. [...] Hier, den „Sessel“ nicht verlassend (das ist eine Anspielung auf ein Wort von Matisse, der sein Kunstideal mit einem bequemen ruhigen Sessel verglich. — A. P.), wandert man durch alle Pole und Tropen der Sinne...“[112]
Nach Maurice Denis erkennt Tugendhold bei Matisse das Streben nach dem Absoluten. Es ist dies jedoch eine östliche Begierde des Absoluten, wie er das in der nächsten Ausgabe seines Essays über die Galerie Stschukin präzisieren wird.[113] Und im Ergebnis ist Matisse für Tugendhold keine große Kunst, sondern eine heitere Kunst, fröhliches Handwerk. Seine Rechtfertigung liegt in seiner sozialen Funktion: eine Zierde zu sein, der psychisch-physiologischen Labung zu dienen, die so notwendig ist in unserem Jahrhundert der amerikanischen Hast. Doch nun ein anderer Kritiker, Pjotr Perzow.[114] Im Unterschied zu Tugendhold ist er von der reinen Malerei Matisses nicht bezaubert. Er stammt aus einem anderen Milieu, der bereits in die Vergangenheit zurückentlassenen literatur-symbolischen Kultur der Jahrhundertwende. Und obwohl er bei Matisse selbst Worte über dessen religiöse Lebensempfindung entdeckt, bezweifelt er sie entschieden, und es ist ihm unmöglich, sein empörtes Befremden zu verbergen: „Es ist schwer, sich eine unglücklichere Selbstcharakteristik vorzustellen.“ Für Perzow hat „Matisses farbiger Kinematograph kein Libretto. Über diese Bilder gibt es nichts zu „erzählen“, man kann sie nur ansehen“. Doch das allein ist nach der Ansicht des Kritikers ungenügend für die Malerei. Und in den Matisseschen Porträts ohne Psychologismus, in den Kompositionen mit Figurenarabesken ohne Gesichter, in all dem erkennt Perzow nur ein malerisches Konzept der Realität, das wie in der Mathematik auf einige „algebraische“ Bezeichnungen reduziert ist. Sein Schlussurteil: Diese ornamentaldekorative Kunst ist ein Beispiel von geistigem Atavismus.
Nachdem er auf diese Art Matisse „zur Strecke gebracht hat“, geht Perzow zu Picasso über: „... was für ein gewaltiger Unterschied im Eindruck, im ganzen geistigen Inhalt zwischen den beiden größten Malern des zeitgenössischen Frankreichs! [...] Als lägen zwischen ihnen Welten von Entfernungen im Raum und in der Zeit... Im gleichen Maße wie der Orientalist Matisse „inhaltslos“ ist, ist der Westler Picasso „vom Inhalt“ gesättigt wie ein wahrer Sohn der arischen Kultur, der diesen unwillkürlichen „Dienst des Geistes“ an sich selbst nicht einmal bemerkt.“[115]
Das Schaffen als Dienst am Geiste, Kunst, in der es einen Inhalt gibt, d. h. ein philosophisches Erfassen der Welt, eine ästhetische Antwort auf die metaphysische Aufgabe — das sind im Falle Picassos die allgemeinen Urteile Perzows, und da gibt es für den symbolisch gestimmten russischen Kritiker etwas zu erzählen. Hier muss bemerkt werden, dass die Vorstellung von Picasso als ungewolltem Mystiker, dessen Werke etwas anderes darstellen, mehr als ihr Autor selbst vermutet, nicht nur für Perzow kennzeichnend ist, sondern für einen ganzen Kreis von Intellektuellen Russlands, die ihre Aussagen über Picasso hinterließen. Einige von ihnen waren wie auch Perzow mit der Bewegung des literarischen Symbolismus verbunden, z. B. Georgi Tschulkow. Andere waren Vertreter der mystisch-theosophischen Gedankenströmung der Jahre um 1910: Sergej Bulgakow, Nikolai Berdjajew. Nur Jakob Tugendhold war ein professioneller Kunstkritiker, der allerdings zu kulturphilosophischen Verallgemeinerungen neigte.
In ihre peinigend scharfen geistigen Probleme versunken, von eschatologischen Vorahnungen ergriffen, sahen sie die „Klosterzelle“ Picassos bei Stschukin am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Aus eigenen Gedanken, Eindrücken und aus den raren Zügen der realen Biographie des Malers schufen sie seine Imageinterpretation, die weniger einer künstlerischen Kritik ähnelt als vielmehr einem „Selbstbekenntnis der Söhne des Jahrhunderts“, das auf das Schaffen Picassos projeziert wurde. Es ist kennzeichnend, dass gerade das Werk Picassos dazu erwählt wurde. In der Tat wurde das Verhältnis schon von der Schwelle aus bestimmt, nach dem ersten Eindruck, der allerdings überaus tief war. „Wenn man das Zimmer Picassos in der Galerie S. I. Stschukins betritt, so wird man von dem Gefühl einer unheimlichen Angst ergriffen; was man empfindet, ist nicht nur mit der Malerei verbunden und dem Schicksal der Kunst, sondern mit dem Leben des Weltalls selbst und seinem Schicksal“[116], schrieb Nikolai Berdjajew in einem Aufsatz.
„In diesem Zimmer fühlt man sich sofort so, als würde man über die Grenzen der ganzen übrigen Kunst hinausgetragen... Vor Ihnen ist etwas so äußerst Merkwürdiges, Ungewöhnliches, Schreckliches, dass man in den ersten Minuten anzuerkennen zögert: Ist das Kunst?“ schreibt Perzow und entwickelt seine Eindrücke so weiter: „Ein russischer Schriftsteller — S. N. Bulgakow — verglich das Schaffen Picassos mit dem Monolog Swidrigailows in Schuld und Sühne von Dostojewski über die Ewigkeit, die in der Form einer mit Spinnen angefüllten engen Bauernhütte vorgestellt wird. Und tatsächlich, etwas Ähnliches stellt dieses Zimmer dar, und einen „Spinnen“-Eindruck erwecken diese an den Wänden ausgehängten, unheildrohenden Bilder, wo vor allem die scharfen, langen Linien der Zeichnung in die Augen stechen.“[117]
Hier geht es um die Bilder der Jahre 1907-1909. Gerade sie nannte man damals Kubismus, und die Periode von 1910 bis 1914 galt als kubo-futuristisch. Diese sogenannten kubistischen Sachen bildeten die Hälfte aller „Picassos“ bei Stschukin und beherrschten alle übrigen Werke.
Aber das Gefühl der schrecklichen Angst, das die Bilder Picassos einflößten, der Eindruck von etwas Merkwürdigem, Ungewöhnlichem, Entsetzlichem stieß die russischen Denker nicht ab, ließ sie ihn nicht verurteilen. Abgestoßen wurden sie im Gegenteil von dem „fröhlichen Handwerk“ Matisses, dem in ihren Augen Picasso entgegengesetzten Pol, der den von geheimnisvollen symbolischen Bedeutungen erfüllten „goldenen Schlaf“ Gauguins ersetzte. Picasso aber zog sie wie ein Magnet durch all das an, was sie in ihm an Gespanntem, Ernstem, Pessimistischem, Philosophischem fanden. Er war für sie wahrhaft das tägliche Brot.
Vor seinen Bildern fühlten sie sich gleichsam am Rande des Abgrundes, gleichsam vor irgendwelchen schwarzen Ikonen, aus denen eine unbestimmte schwarze Glückseligkeit herausfließt, die sich, nach den Worten Bulgakows, die von Perzow aufgegriffen wurden, in dem Zimmer beinahe physisch bemerkbar machte. Andere finden ähnliche Worte für den Ausdruck derselben Gedanken. So sind für Georgi Tschulkow die Bilder Picassos Hieroglyphen des Satans, denn seiner Überzeugung nach gibt es keine diesen Formen entsprechenden Erlebnisse außer der Hölle, und nach der Meinung Perzows ist in diesem farbigen Geometrismus zuviel von der wahren Mystik, um ganz an seine formale Maske glauben zu können. Das metaphysische Kunstgebäude Picassos versteht er als eine höllische Offenbarung, und den Fachausdruck „Kubismus“ benutzt er lediglich, um dem Vokabular der künstlerischen Kritik seinen Tribut zu zollen. „Unheimliche Empfindung einer sich außerhalb der Welt befindenden Einsicht, physisches Verbrennen der Höllenflamme liegt in der Luft der kubistischen Bilder Picassos“[118], schreibt Perzow.
Es ist hier nicht zu übersehen, dass eine ähnliche Auffassung von einer wahren Kunst sowie der Wortschatz dieser Urteile und Meditationen auch den russischen Dichter-Symbolisten der Jahrhundertwende eigen sind. Bei Alexander Block lesen wir im Programmartikel des Jahres 1910 Über den zeitgenössischen Zustand des russischen Symbolismus: „Die Kunst ist die Hölle. Nicht umsonst vermachte W. Brjussow dem Maler diesen Ausspruch: ‘Wie Dante muss dir die unterirdische Flamme die Wangen verbrennen’.“[119]
Sogar bei dem Kritiker Tugendhold liegt im Subtext seiner Analyse der schöpferischen Persönlichkeit Picassos das Schwergewicht der Gedanken nicht auf den ästhetischen Gesetzmäßigkeiten und Problemen, sondern auf dem mystisch-dämonischen Wesen, das im Nationalcharakter des Malers verborgen sei. „Picasso ist ein wahrer Spanier, der den religiösen Mystizismus mit dem Fanatismus der Wahrheit vereinigt.“ Oder: „Er wird immer ein Fanatiker und Spanier, der zum Transzendenten geneigt ist, bleiben.“ Und an anderer Stelle: „Mit der fanatischen Kälte eines spanischen Inquisitors wird er zum Fanatiker der reinen Idee.“[120]
Der Mystizismus und das Transzendentale sind für Tugendhold unabänderliche Eigenschaften der geistigen und schöpferischen Persönlichkeit Picassos von seinem Debüt bis zu den letzten Arbeiten. Wenn, seiner Meinung nach, „die blaue Serie in der Gestalt von Picasso einen großen und tiefen Maler verhieß [...] er könnte ein neuer Puvis de Chavannes sein, er könnte tiefer und religiöser als Puvis de Chavannes sein“, so offenbaren sich dem Kritiker in dem formalen Aufbau des frühkubistischen Stilllebens Die Fabrik wahrhaft faustische — gnostische — Wahrheiten.
Seine Analyse dieses Werkes ist erstaunlich. „Die Linien der Wände und der Dächer dieser „Fabrik“ begegnen sich nicht in Richtung zum Horizont... sondern gehen in die Breite, laufen in die Unendlichkeit auseinander. Hier gibt es schon keinen innerlichen Treffpunkt mehr, keinen Horizont, keine Optik des menschlichen Auges, keinen Anfang und kein Ende — hier ist die Kälte und der Wahnsinn des absoluten Raumes. Und sogar die Lichtreflexe der Spiegelwände dieser „Fabrik“ spielen mit zahllosen Wiederholungen, spiegeln sich im Himmel wider — machen die „Fabrik“ zum verzauberten Labyrinth der Spiegel, zur Sinnestäuschung des Fieberwahns... Denn man konnte wirklich von dieser Idee und der Versuchung, die eines Iwan Karamasow würdig wäre, verrückt werden: Es gibt kein Ende, keine Einheit, keinen Menschen als das Maß aller Dinge — es gibt nur den Kosmos, nur ein endloses Zerstückeln der Volumen im endlosen Raum!“[121]
Hier sehen wir wieder — und das ist der kennzeichnende Zug aller russischen Rezensenten Picassos — die Hinwendung zur literarischen Analogie für die Klärung des geistigen und schöpferischen Wesens des Malers. Die Literaten, selbst durch eine große literarische Tradition erzogen, erinnerten sich bald an die Helden der „menschlichen Tragödie“ Dostojewskis (Bulgakow, Perzow, Tugendhold), bald an die verdichtete Empfindung des „diabolischen Antlitzes der Welt“ bei Gogol (Perzow).
Und so ist ein auf diese Weise von ihnen aufgefasster und in ihren Artikeln beschriebener Picasso eine Art Über-Maler: Ein geniales Sprachrohr des pessimistischen Dämonismus für Tschulkow, ein geniales Sprachrohr der Zersetzung, der Auflösung, der Verstreuung der physischen, körperlichen, realen Welt für Berdjajew, heldenmütiger spanischer Don Quichotte, ein Ritter des Absoluten, Glaubenseiferer der Mathematik, der zur ewigen erfolglosen Suche verdammt war, und zugleich der erste in der zeitgenössischen dekadenten Kunst für Tugendhold.
Bei gewissen äußeren Unterschieden der angeführten Urteile (ihre Zahl könnte leicht erweitert werden) gleichen sie alle den Aspekten eines einzigen sinnlichen Bildes, nach dessen geheimem Modell ähnliche Imageinterpretationen Picassos geschaffen wurden. Gehen wir einmal das Risiko ein anzunehmen, dass dieses geheime Modell dem aus der russischen romantischen Tradition stammenden und durch das symbolistische Bewusstsein um die Jahrhundertwende wiederbelebten Bild des Wrubelschen „Dämon-Nietzscheaners“ diente. Das ist das kennzeichnende russische Wesen des verfluchten Künstlers, der dem dekorativen Paradies zutiefst fremd ist, des verschmähten Maler-Einzelgängers, der in der Hölle der Kunst zum Tod verdammt ist. So spricht Perzow vom möglichen Untergang Picassos, der dem Ende des Gogolschen Prototyps, des Helden der Novelle Das Porträt, ähnlich sein könnte. Georgi Tschulkow schließt seinen Essay so: „Der Untergang Picassos ist tragisch. Aber wie blind und naiv sind diejenigen, die meinen, dass man Picasso nachahmen und von ihm lernen muss. Was lernen? Diese Formen haben ja keine entsprechenden Erlebnisse außerhalb der Hölle. Aber in der Hölle zu sein heißt den Tod vorwegnehmen. Über diese letzte und äußerste Kenntnis verfügen die Herren Kubisten wohl kaum.“[122]
Der Untergang Picassos — sei es auch ein symbolischer — musste unvermeidlich das von seinen ersten russischen Rezensenten geschaffene Bild von dem großen zeitgenössischen Maler krönen, das zugleich eines der zahlreichen Abbilder Picassos im Bewusstsein seiner Zeitgenossen war. Vieles von dem über den Maler im Russland der Jahre um 1900 Gesagten blieb unerschütterlich und wird heute von uns neu entdeckt.
„Es ist theoretisch unmöglich zuzulassen“, schrieb Perzow, „dass ein einfaches Stillleben — irgendeine Flasche, irgendeine Vase mit Früchten, irgendein Apothekergeschirr — von einem Gefühl der Negation der Welt und der grenzenlosen Hoffnungslosigkeit durchdrungen sein könnte. Betretet aber das Zimmer Picassos — und ihr werdet dieses Wunder sehen...“[123]
Noch früher wurde auch Tschulkow davon überrascht: „Bei Picasso gibt es ein Stillleben — Tongefäße und eine große bauchige Flasche auf dem Rand des Tisches, der in eine Ecke geschoben ist. Die asketische Strenge der Farbe, die äußerste Einfachheit der Zeichnung, nachdrückliche Abwesenheit der Vorsätzlichkeit und zugleich die unwahrscheinliche, erstaunliche Ausdruckskraft der Form und hinter der Form eine außergewöhnliche Tragweite der Erlebnisse, die dieser genial gefundenen Form vollkommen adäquat sind! Ich kenne kein schrecklicheres Bild als dieses Stillleben Picassos.“[124] Ist es nicht erstaunlich, dass all das von einer Kunst gesagt wird, die überall und noch lange danach ihrem Wesen nach als formale betrachtet werden wird, als ein rein plastisches Phänomen? Diese Kunst wurde historisch mit dem Begriff „Kubismus“ verbunden, und bis heute ist die Trägheit des formalen Herangehens ihr gegenüber noch nicht überwunden. Aber in eben diesen Jahren sagte Picasso zu Tugendhold: „Die Flasche auf dem Tisch ist genauso bedeutsam wie ein religiöses Bild.“
Man kann nicht umhin, auch die für das Begreifen des ganzen Schaffens Picassos höchst wichtige Meinung desselben Jakob Tugendhold anzuführen: „Er will die Gegenstände nicht so darstellen, wie sie dem Auge erscheinen, sondern so, wie sie in unserer Vorstellung sind.“ Dieser im Jahr 1914 von einem russischen Kritiker geäußerte Gedanke kam etwa zwanzig, fünfundzwanzig Jahre der eigenen Bekenntnis des Malers zuvor: „Ich male nicht das, was ich sehe, sondern das, was ich denke.“[125]
Aber verlassen wir die scharfsinnigen Urteile der älteren Generation russischer Kritiker der Jahre um 1910, als der Symbolismus, dem sie innerlich treu blieben, schon überholt war. Es waren neue Strömungen in der Malerei und der Poesie entstanden; vor allem die junge Generation suchte nach Neuerungen, nach neuen Ausdrucksformen. Viel bedeutete ihr die Stschukinsche Galerie, weshalb Ternowez sie „eine Art von Akademie der neuen Kunst“ nannte, in der alle stürmischen jungen Moskauer Maler erzogen wurden, und nicht nur die Maler.
Trotz der ganzen Breite des avantgardistischen Suchens konnte sich keine einzige der Strömungen, vom Cézanneismus angefangen bis hin zum Suprematismus, dem tiefen und befreienden Einfluss der Werke Picassos aus den verschiedenen Perioden entziehen, die sich in Stschukins Sammlung befanden. Vor allem regte Picassos Beispiel selbst, des heldenhaften Erneuerers, den Nonkonformismus der linken Maler an, revolutionierte ihr ästhetisches Bewusstsein und steckte sie mit seinem Drang nach Handlung, Handlung, Handlung an. Es ist klar, dass ihre Auffassung von dem jungen Maître der Pariser Avantgarde eine völlig andere war als die der älteren literarischen Zeitgenossen.
So trat Alexej Gristschenko als Maler-Praktiker und Anhänger der „reinen Form“ bezüglich Picassos in eine scharfe Pressepolemik mit Berdjajew und Andrej Bjely ein. „Die Erwähnung des Namens Picassos nach dem von Ciurlionis, eine gleichzeitige Anerkennung der beiden als Genies ist ein überflüssiger und gewichtiger Beweis dafür, dass Berdjajew nichts versteht“, schrieb er. „Ciurlionis und Picasso sind Pole, zwei einander ausschließende Polarerscheinungen... Die Worte des russischen Philosophen erinnern uns ihrem Sinn nach an einen Menschen, der, da er die Erscheinung nicht begreift, vor der Erscheinung bebt und sie übernatürlich nennt.“[126] Für Gristschenko: „Picasso ist keine übernatürliche Erscheinung. Er ist ein guter Maler, der eine Reihe von echten Bildern gemalt hat, die zutiefst auf unsere Vorstellung von der Malerei antworten, erstens; zweitens ist seine Malerei eine natürliche Frucht des organischen Wachsens der Form und der Evolution des Bewusstseins des Malers. Seine besten Bilder werden klassisch sein, wie die Werke Cézannes...“[127] Und er erwähnt die Violine, vielleicht dieselbe, die in jenen Jahren auch Olga Rosanowa kopiert hat und die heute im Puschkin Museum der bildenden Künste ausgestellt ist. In dieser Violine „... ist die neue Konzeption des Bildes mit einer hervorragenden Meisterschaft gelöst... und jedes Stück des Gemäldes entstand unter der Hand eines echten Malers!“ Die Vorstellungen von einem echten Maler und von der Malerei sind bei Alexej Grischenko ernst und erhaben: „Das Bewusstsein erweiternd, es wirklich in konkreten malerischen Formen, in der Gestalt von Bildern verkörpernd, sich einer aus dem Inneren sprechenden Stimme und einem befehlenden Aufruf fügend, erkennt der Maler instinktiv und real in seiner Arbeit die Evolution der Welt und des Menschen, die Evolution seines eigenen Werkes. Durch die Farben und den Aufbau, durch die Formen prägt er materiell und plastisch auf der Leinwand seine Bilder — die Frucht der höchsten Errungenschaften seines Bewusstseins.“[128] Dabei ruft sein besonderes Entzücken gerade jene Periode des Picassoschen Kubismus hervor, die bei Stschukin überhaupt nicht vertreten ist: „Ich habe im Auge“, schreibt er, „die monochromen Bilder des Malers mit dem höchsten zeitgenössischen Verständnis der Form, der Faktur und des Aufbaus, die auf dem Boden des französischen malerischen Genius einen Aufschwung erleben. So den Mann mit der Klarinette in der Sammlung Uhde in Paris.“ (Heute eine private Sammlung, Frankreich. — A. P.) Es lohnt sich zu bemerken, dass auch Kasimir Malewitsch den Mann mit der Klarinette sehr hoch schätzte.
Schließlich darf man auch das erste Buch über Picasso, das erste nicht nur in Russland, sondern in der Welt überhaupt im Jahr 1917 erschienene Buch, nicht ignorieren. Diese Monographie unter dem Titel Picasso und sein Umkreis kam unter der Feder von Innokenti Aksjonow hervor, eines Dichters aus der Vereinigung der Moskauer Kubofuturisten „Zentrifuge“, und war im Juni 1914, laut der Zeitangabe des Verfassers, geschrieben worden.[129]
Das Genre dieser Monographie ist ungewöhnlich — eine Art Essay-Collage aus polemischen Aufzeichnungen, Beobachtungen, Sentenzen, Überlegungen zu ästhetischen und „umgebenden“ Themen. In seiner Denkweise selbst strebt der Autor gleichsam danach, dem bohèmehaften, sarkastischen und paradoxen Geist des „Picassoismus“ zu folgen. So die 313 Paragraphen, die die ersten drei Teile bilden. Im vierten Teil untersucht er ausführlich und durchaus professionell die formal-technische Seite der Meisterschaft Picassos im Verlauf seiner Geschichte.
Der Grund der Untersuchung war das grenzenlose Entzücken des Autors über den nach Theotokopulos herrlichsten Spanier. Unmittelbarer Anlass war auch der Wunsch, Berdjajew und den anderen russischen „Mystikern“, die oben erwähnt wurden, zu widersprechen.
Gerade in diesem Sinne schreibt Aksjonow über Picasso als den reinen Maler, der aus dem Geist der Malerei schafft und „die ganze Kraft seiner Gabe auf die Verwirklichung der elementaren Forderungen dieses außerhalb jedes Imperativs liegenden Geistes der Malerei gerichtet hat und über die Grenzen der Malerei hinaus geworfen worden war, weil die „Darstellungsgraphie“ in den Fesseln der Möglichkeiten der Öltempera ihren Atem verliert, wie die Musik in dem Zwölfnotengitter der temperierten Folge. Picasso ist der Versuch, die überlebte Technik zu überwinden und den Grundstein für eine Malerei mit den Mitteln gleich welchen Stoffes zu legen.“[130]
Im schöpferischen Prozess Picassos gibt es für Aksjonow keine Mystik. Die „rot-braune Periode des Jahres 1908“ betrachtet er eigentlich als die Übergangsperiode, aber da sie in der Stschukinschen Galerie mit einer derartigen Zahl von Gemälden vertreten ist, kann man hinsichtlich ihrer Bedeutung für den allgemeinen Prozess in Zweifel geraten.
Den eschatologischen Vorahnungen Berdjajews bezüglich Picasso setzt Aksjonow im Grunde nicht so sehr das System seiner Auffassungen von der Kunst im Ganzen, insbesondere von der zeitgenössischen Kunst, sondern einfach sein Entzücken über den Maler, den er persönlich kannte, und seine instinktive Liebe zu seinem Schaffen entgegen. Und das, so scheint es, verlieh dem Verfasser von Picasso und sein Umkreis eine besondere Auffassungsgabe, die Richtigkeit und die Klarheit in seinen scharfsinnigen Urteilen, besonders dort, wo es um das Wesen selbst geht, um den geheimen Nerv der schöpferischen Persönlichkeit des Meisters. Das sind nur einige der wichtigsten Beispiele.
Über die metaphorische Vision Picassos als Kubist schreibt Aksjonow: „Die Mystik der Dinge Picassos hat genau dieselbe Wurzel wie das Geheimnisvolle der Gespenster, die aus einem Stuhl, einem Rock und einem herabhängenden gesteiften Vorhemd bestehen. Das Erschrecken über diese Gegenstände belustigt manche Federfuchser, aber diese Erscheinung verdient Aufmerksamkeit.“[131]
Und wirklich, hier wird ja von den künftigen surrealistischen Montagen und auch von den Skulpturen-Assemblagen Picassos der dreißiger bis fünfziger Jahre gesprochen. Da lesen wir über die optische, d. h. reale Natur der sogenannten Deformationen im Kubismus: „Picasso betrachtet seine Gegenstände aus nächster Nähe, so nah, wie man das Gesicht der Geliebten ansieht.“[132] Hat der Maler die Richtigkeit dieser Worte durch seine Frauenporträts der 30er Jahre nicht selbst bestätigt?
Und noch ein Beispiel. Nichts von den sogenannten Ingresschen Zeichnungen der Jahre 1915-1917 wissend, lange vor dem Beginn des sogenannten Neoklassizismus der 20er Jahre, fern von Paris, vermutet Innokenti Aksjonow, nein — prophezeit er: „Beabsichtigt dieser Porträtist zahlloser Violinen, nachdem er seine unvorsichtigen Begleiter in den Papier- und Blechdschungel geführt hat, nicht durch eine unverhohlene Synthese eines Realismus auf höherer Ebene zu ihnen zurückzukehren?“[133] Als hätte er es geahnt... Als Epigraph zu seinem Buch wählte Aksjonow die Worte Grigori Nisskis: „Die einen verstehen Gott als Feuer, die anderen als Licht.“ Für ihn selbst war Picasso nicht das Höllenfeuer, sondern die Flamme des Schöpfertums. „Aber“, schreibt Innokenti Aksjonow, „wir stimmen auch hier mit ihm überein, jenes Feuer ist vernünftig und der Ursprung der Weltordnung.“
Guernica, 1937. Öl auf Leinwand, 349,3 x 776,6 cm. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid.